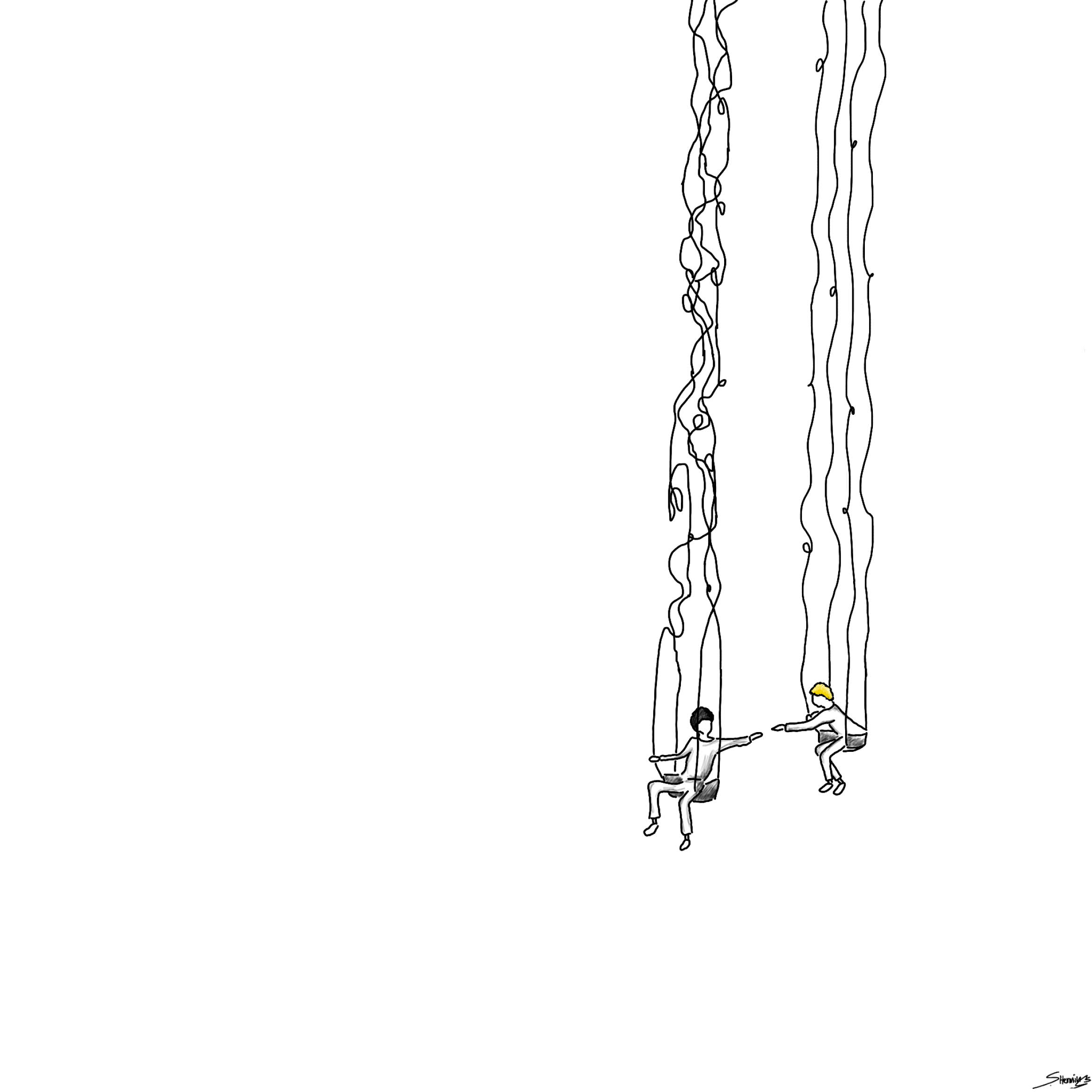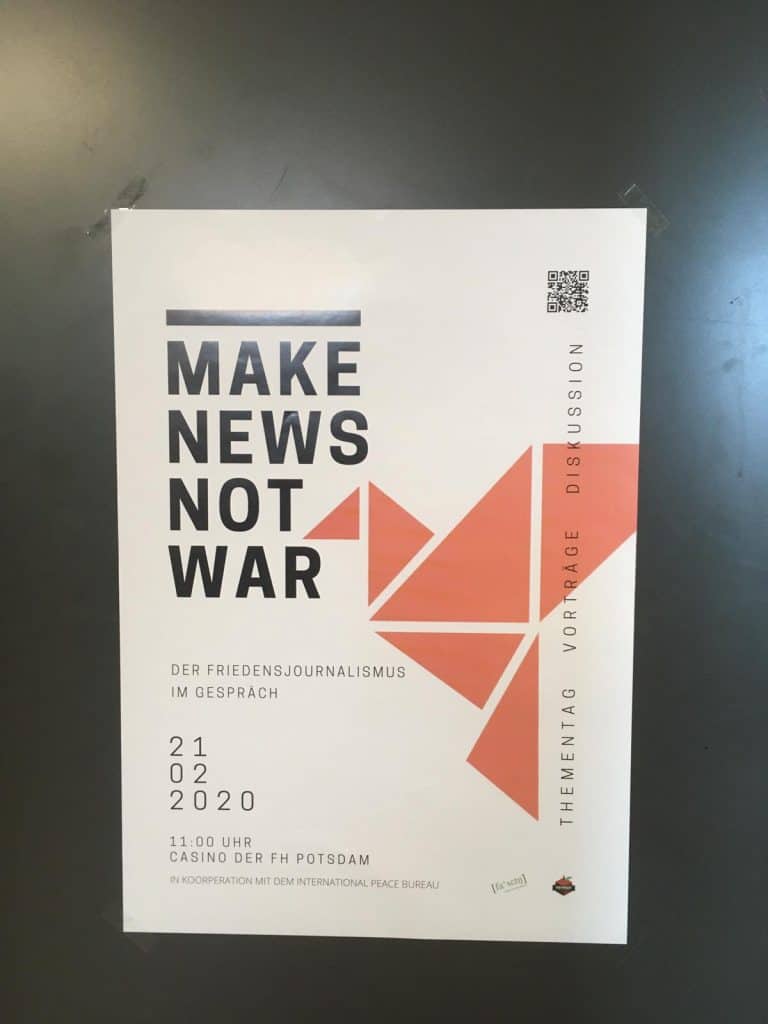Was ich wirklich nie vergessen will – Poetry Slam
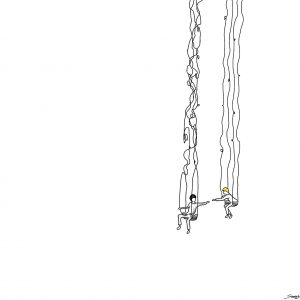
Dieser Poetry Slam ist auf der Suche nach dem vergessenen Optimismus. Was hilft dem überdrehten Oskar aus seinen sich in der Abstraktion verlierenden Problemen? Was ist es, dass er wirklich nie (wieder) vergessen will? Von Björn Ole Müller.
Es ist wieder Saison
Wenn draußen die Straße ruhig zwischen den Häusern liegt, die Laterne im Dämmerlicht flackert – bebt und in meinem Zimmer das Licht ausgeht. Dann, weil die Birne kurz vorm Durchbrennen steht. Das letzte Auto sich in der Ruhe wiegt, nur noch den eigenen Scheinwerfer sieht und sich alles in mir um die eigene Achse dreht. Wenn‘s weder mit, noch ohne Musik geht, das Herz nicht nur rast, sondern unter der Schädeldecke schlägt, klopft, hämmert, pumpt, eine Stechuhr, die mein Geist nur zu gut kennt, die einzige, die er versteht.
Wenn draußen der Wind lau, sanft über den Großstadtmüll streicht, Pollen und Kippen in große Berge wiegt und vor einem neu anbrechenden Tag alles mal ordentlich durchfegt, über meine Stadt laut ein Hurrikan niedergeht, der Widerstand die Faust erhebt, mein Kopf eine Revolution erlebt, Frieden sich endlich wieder legt und Stress sich – seiner bewusst – seinen Platz eingesteht, einen im verfickten Tumult erregt, Grenzen der Belastbarkeit verlegt, wie Bahnschienen eines panischen Güterverkehrs – Austausch zwischen Zusammenbruch und Flucht, man sich selbst durchdenkt, zerdenkt, am Arsch klebt, ist wieder Zeit, die neue Saison, in der man hektisch lebt.
Die, in der vor meinem Fenster in pedantischen Längenvorgaben der Rasen im Dünger der Großstadtvierbeiner steht, eine fette Zeit verlebt, der Geruch durch den Fensterspalt schwebt und auch mein Rasen düngt. Sich mischt mit der Scheiße, die in mir abgeht, also der Dreck von außen, der in mir nach Bearbeitung fleht und ich flehend das Arbeiten niederlegen will, steter Strom Strukturen zerstäubt, Puls nicht belebt, sondern betäubt, ist es wieder soweit, was staute, gestaut wurde, bricht los, tritt über die Ufer, wie Flüsse, in die die Welt heult, sich auskotzt, den Dreck übers Ufer steuert und für alle sichtbar seine Erscheinung säumt.
Gedankenflut
Das große Ganze sich vom Schmutz befreit, es in schwarze Ringe reiht, unter die Augen legt. Ich in meinem dunklen Zimmer, in dem abends das Licht ausgeht. Wenn Angst haltlos, parasitär wird, meine Zweifel ihr Wirt, würd‘ ich alles geben, will ich alles geben, dass Ruhe mit mir in Symbiose tritt, würd‘ alles tun, Gedanken mit Füßen treten, doch mit einem Stein, den man sich dadurch nur tiefer ins Gemüt tritt, muss ich still halten, meinen Lebensstil halten, also praktisch still das Ruder halten, in der Flut meiner Gedanken. Bin hier immerhin allein, verlassen, denn nicht mal die Feinde wollen dieses Boot entern, ich – die einzige Gefahr, in meinem Kopf zu kentern, deshalb lieber festhalten, das Ruder nicht loslassen, es bloß lassen, darüber nachzudenken – reicht doch einer, ein einziger falscher Gedanke, um das Schiff zu versenken.
Doch ich kann es nicht lassen, ich denke. Das heißt dann nach dem Sturm nur noch den Mast zu sehen, der in Senke senkrecht steht, und mit dem, was das Boot zerstörte, dasselbe wieder aufzubauen, drauf zu bauen, dass Kraft kommt, die mir hilft, den Verstörten aufbauen kann. Den Karren aus dem Dreck, also den Kahn aus dem Wasser zieht, doch das geht nur, wenn ich den Sturm ziehen lass‘, Reparatur ist doppelte Last, wenn Wind dir das neue Brett entzieht, dass man einzieht, es über die Berge wegfliegt. Wo soll die Kraft her kommen?; weiß ja nicht mal, wie man Berge ohne Material versetzt, man mit bloßer Hand Granit besiegt. Es dreht sich alles weiter und das Herz schlägt, klopft, hämmert, pumpt, es versetzt mich alles in eine schwierige Lage, ich lebe auf Pump der letzten positiven Gedanken, die hämmer‘ ich mir ins Gedächtnis, halt sie fest, weil die Panik schon an die Tür klopft, und ist sie drin, denen in die Fresse schlägt, bis es bricht, das Herz.
Doch nicht vergessen?
Und ich stehe so kurz davor. Kurz vorm Bruch, die Panik macht Druck und die einzige Hilfe, die ich habe, ist die Selbstachtung, die sich vor jeder Gewalt wegduckt. Die Angst spuckt mir ins Gesicht, ist der Spuk, der mir ins Gesicht geschrieben steht und auch ich will mich ducken, will mich krümmen, lass mich bespucken, bis ich meine Rettung seh‘. Ich dacht‘ ich wär‘ verloren, lieg‘ doch schon erstickend am Boden vom See, den Boden unter den Füßen verloren. Ich fühle mich allein, in meinen Tränen nach Luft geschnappt, das Wasser, scheinbar endgültig, über dem Kopf zusammengeschwappt.
Doch da ist etwas. Auch auf der Schulter meiner scheinbar unbesiegbaren Panik landete einst ein Lindenblatt, als es in meinem Blut badete. Ich sehe es nun ganz deutlich vor mir, ein Rotorblatt, das das Blatt für mich wendet. Ich löse den Flugmodus und schreie nach Hilfe, am anderen Ende die Stimme, die es beendet. Der Held dieser verqueren Nibelungensage hört mich, versteht, was ich sage und jedes Wort, das gesagt wird, nimmt mehr Anlauf, um die Lanze zu werfen. Er steht – allein – gegenübergestellt, was ich nicht besiegen kann, doch er kann, dem Kampf gestellt, auch seine Psyche geprellt, egal, er steht… für uns beide, fällt nicht, zweifelt nicht, ist da, da – nur für mich.
Wenn ich am Boden bin, ihn gleichermaßen verliere, steht er auf ihm und stellt mich hin, ich steh und er erringt den Sieg – für mich. Macht immer wieder Platz für mich auf meinem Thron, nur die Zeit mit mir, die Zeit, die wir verbringen, ist sein Lohn. Wir reden, er stößt zu, Angst getroffen, beginnt sich auf den Rücken zu werfen, erstmals reißen nicht mir, sondern ihr die Nerven und ihr Blut sickert zwar in meine Nervenzellen, um eines Tages wiederzukommen, aber ich stehe nicht allein, habe für mich einen Helden, der zur Lanze greift, der mit Worten Taten spricht und mich erlösen kann. Ein weiteres Mal dank ihm gewonnen. Bin aufgetaucht, zurückgekommen, denn scheißegal, was mir passiert, was mich kettet, er hat es geschafft, mein Held – mit einem Anruf hat er mich gerettet. Und wer denkt, wer sowas schreibt, der hat’s nicht leicht, der irrt, ich habe Helden, jeder für sich, der Wege erdet und mir neue zeigt, jeder da, nur für mich. Der Gewinner in dieser Geschichte bin also zweifelsfrei…ich.
Hat es dir gefallen? Diesen und andere Poetry Slams von unserem Autoren Björn Ole Müller findest du, auch zum Anhören, auf dem YouTube-Kanal Nur mal so ein Gedanke.