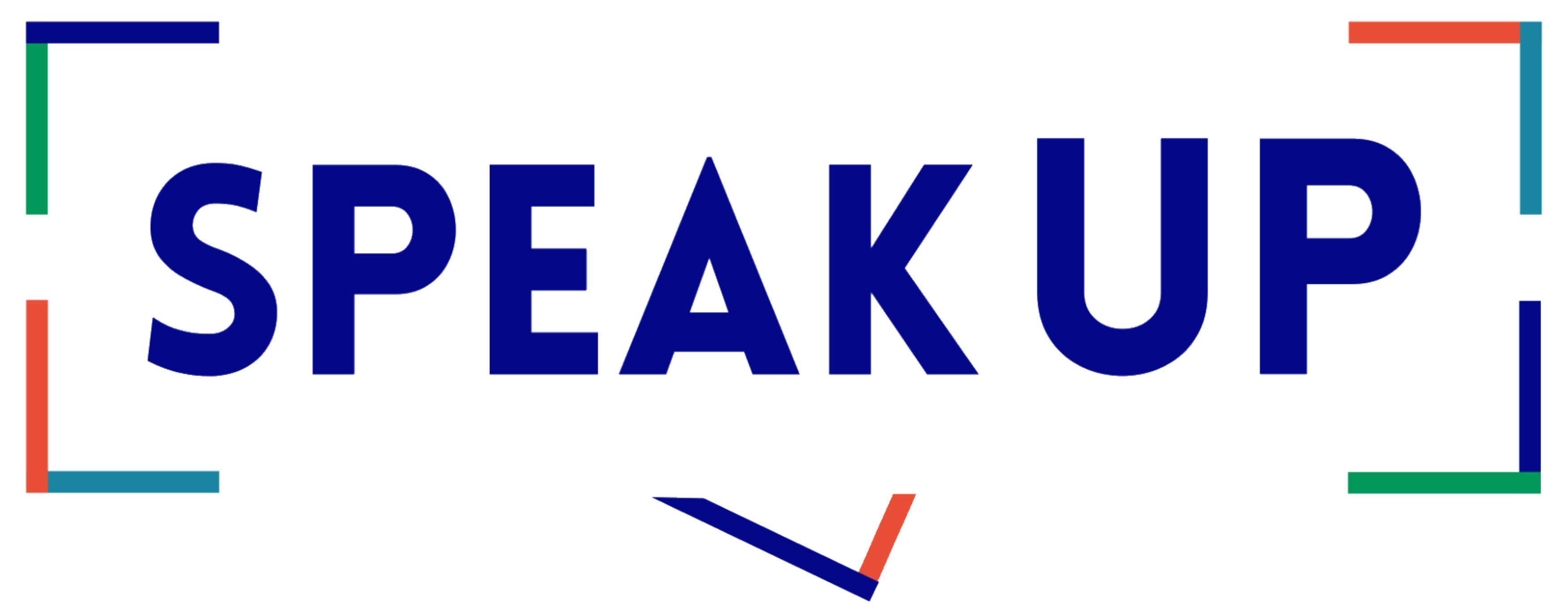Feministischer Kampftag oder, wie überleben wir den Backlash?

Was bedeutet es im reaktionären Deutschland, eine Frau* zu sein? Sind Selbstbestimmtheit und gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft Ziele, die nie erreicht werden können? Und wie können wir uns als Teile einer vielfältigen und queeren feministischen Bewegung unsere psychische Gesundheit bewahren, um nicht an den Herausforderungen, die uns auf dem Weg begegnen, zu verzweifeln?
Kommentar von Emily Scholz
1. Reflektion
Eine starke Frau. Was soll das sein?
Als ob Stärke für Nicht-Frauen gepachtet wäre, Ausnahmen aber für wie gewöhnlich die Regel bestätigen dürfen. Wenn ich mich stark fühle, tu´ ich das nicht, obwohl ich eine Frau bin.
Zwar fühle ich mich in einem Moment der Selbstvergewisserung mehr als einfache Person, als ich eben, als alles andere (Geschlechterbezeichnungen usw.).
Doch gibt es Situationen, Umstände und Zeiten, in denen ich besonders stark sein muss, weil ich eine Frau bin.
Sei es die Auseinandersetzung mit einem Mitbewohner, der sich mir gegenüber als besonders bedürftig für Fürsorge verhielt und „Beziehungsarbeit“ zu meiner Aufgabe werden ließ.
Oder ein ehemaliger Arbeitgeber, der auf eine Frage zum Arbeitsablauf beteuerte, es gebe „hier keine Hierarchien“ (eine spannende Behauptung für behördliche Institutionen).
Interessanterweise jedoch sind Liebesbeziehungen der Ort, an der sich Ungerechtigkeitserfahrungen, umso hartnäckiger „halten“. Auch auf Freundschaften kann das zutreffen.
Während ich aus der Perspektive einer gesellschaftlich als weiblich gelesenen Person schreibe, möchte ich betonen, dass die Dichotomie von geschlechterspezifischer Macht und Gewaltverhältnissen sich nicht an den beiden typisierten binären Geschlechterrollen, männlich, weiblich, festmachen oder auf diese beschränken ließe. Gleichsam gibt es dominante Frauen*, oder unterwürfige, sich als männlich identifizierende Personen.
Meine Frage ist vielmehr eine innerpsychisch emotionale und zugleich soziale: Woraus ziehen wir als gesellschafts- sowie fürsorgebedürftige Menschen Selbstwirksamkeit? Hierunter wird in der Kognitionspsychologie die Überzeugung einer Person, auch schwierige Situationen und Herausforderungen aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen zu können, verstanden.
Also, wann habe ich die innere Gewissheit, das sichere Gefühl, dass mich Hindernisse, denen ich begegne, so schnell nicht aus der Bahn werfen?
Es handelt sich hierbei um die Identifikation mit sich selbst.
All´ die Übungen der Grenzziehung, das in sich Hineinhören, können nicht ihre Wirkung entfalten, wenn ich mich nicht als das, was ich bin, akzeptiere und gleichermaßen respektiere.
Und zwar vor allen Dingen, privat, wie auch als das „Ich“, welches sozial, also zwischenmenschlich in möglichen Rollen, die wir in unserem mitmenschlichen Alltag verkörpern, agiert. Sei es als Freund*in, Schwester, arbeitende Person, als Großmutter oder Aktivistin.
Dabei muss Selbstrespekt als von Diskriminierungen betroffene Personen vor allem auch bedeuten, hinreichend frei zu sein, die eigene Stimme zu erheben.
„Sei einfach du selbst“. Eine Aufforderung, fast schon Mahnung, die wir sicher alle schon einmal gehört haben. Doch das ist nicht immer selbstverständlich. Da alle Menschen ein stabiles Fundament, von welchem sie sich aus weiterentwickeln können, brauchen, erfordert der Erhalt des Ichs die Selbstfürsorge, beispielsweise in Form des Erhalts der sogenannten emotionalen Integrität. Letztere gilt es vor allem in zwischenmenschlichen Beziehungen zu erhalten.
Während die ersten Fürsorgebeziehungen, die wir oder die wir nicht erleben, wohl mit am meisten zur Prägung der eigenen „Grundpersönlichkeit“ beitragen. Gibt uns jede weitere Beziehung zu Mitmenschen, sei es durch als belastend empfundenes oder für uns bestärkend markierte Einflüsse, die Möglichkeit, das eigene Leben selbstbestimmt und unserem Kohärenz- oder auch Fairnessgefühl entsprechend zu erleben und gestalten.
Während Freundschaften uns von innen stärken können, tragen auch Konflikte dazu bei, dass das „Selbst“ als eigenständig wahrgenommen wird.
Wie im gesellschaftlichen Alltag, wo Beteiligte als Teile einer Gruppe, untereinander in Relation stehend, Institutionen bilden können, sich jedoch nicht völlig „symbiotisch“ mit diesen identifizieren müssen.
Auch hier sind ein Selbstverständnis als „different“, also sich von anderen Menschen unterscheidend zu betrachten, sowie sich fühlend wahrzunehmen, integrale Bestandteile zur selbstbestimmten Bewältigung verschiedener Tätigkeiten. Das gilt vor allem bei möglicherweise zugleich empfundenem Anpassungsdruck.
Als hilfreiches Vorgehen kann hier „Achtsamkeit“ als die nach innen gerichtete Aufmerksamkeit, die Souveränität über den eigenen Körper, die eigenen Empfindung und hieran gekoppelte Bedürfnisse bewahren.
2. Ausblick
Alles in allem ist also einiges an Liebes-Mühe von Nöten, für den inneren wie den im Außen wirkungsvollen Selbsterhalt.
Zur Änderung bestehender vielzähliger Machtverhältnisse, genügt nicht ein kritischer Blick auf das Änderungswürdige. Auch Liebe oder „Vergebung“ allein vermögen erlebtes Unrecht nicht rückgängig oder wieder „gut“ zu machen. Was es als Subjekt im derzeit reaktionären sozialen Umbruch braucht, ist vor allem, nicht stattfindenden Einschüchterungen durch, sehr nachvollziehbar empfundene lähmende Angst oder destruktive Wut, zu erliegen.
Dabei kann helfen, sich mit vertrauenswürdigen Menschen zu verbinden und nicht all zu hart mit sich ins „Gericht zu gehen“. Verschiedenen Benachteiligungen ausgesetzte Menschen dürfen nicht klein beigeben. Der Karren wird sich leider nicht selbst aus dem Dreck ziehen.
Daher sollte der feministische Kampftag zum Anlass genommen werden, um gemeinsam Aufmerksamkeit und Dankbarkeit für jene zu kultivieren, die täglich ihr Bestes geben, um schlichtweg zu überleben. Die Verschiedenheit oder soziologisch „Differenz“ ist dabei gerade als queere Frau etwas, das mir am Herzen liegt.
Nur indem wir anerkennen, dass grundlegende Unterschiede nicht trennen, sondern als Grund für gegenseitigen Respekt und Gleichwertigkeit zu sehen sind, gelangen wir zurück zu wirklicher Unabhängigkeit. Im Alltag bedeutet dies, Verantwortung für das eigene Wohlergehen zu übernehmen. Aber auch unbeirrbar kämpferisch in ambitionierten Forderungen zu bleiben.