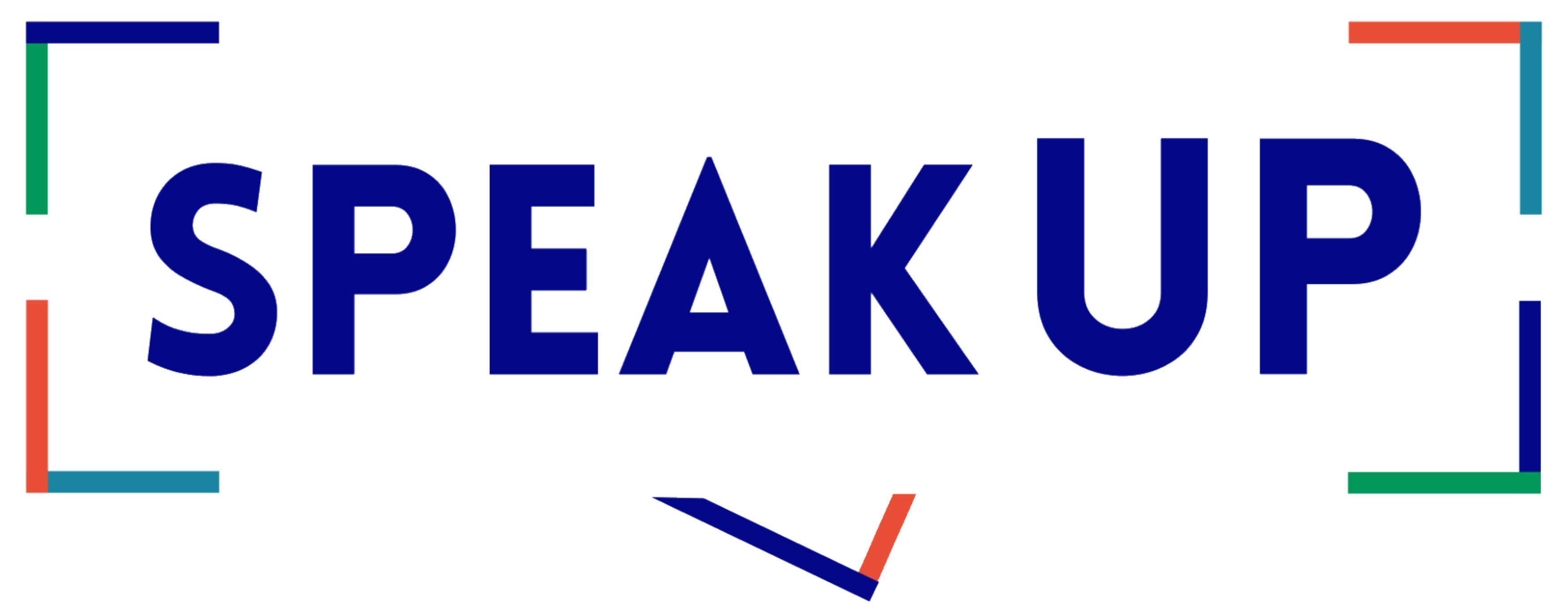Für immer Kreidezeit? Hinter marodierenden Kulissen einer Fachkultur

Als Student*in hast Du dich sicherlich schon einmal gefragt, warum die Prüfungsordnung deines Studiengangs in Stein gemeißelt zu sein scheint. Oder vielleicht hast du dich darüber geärgert, deinen Interessensgebieten zu selten im Studienverlauf zu begegnen.
Und wenn Frust aufkommt, sind schlechte Ergebnisse nicht weit. Daher nehmen wir das Thema der Studienreformen einmal unter die Lupe:
Was muss sich ändern, wo zeichnen sich bereits Ansätze ab und wer sind die “Verantwortlichen”?
Bevor wir weiter im Fundus aus Frustration, Enttäuschung und Meinungsverschiedenheiten kramen. Um welche Fachkultur soll es eigentlich gehen? Natürlich geht es um jene, welche sich die Fähigkeit, zu streiten, selbst auf die Fahnen geschrieben hat:
Die Rechtswissenschaft.
So trifft es sich, dass zur Thematik der Reformierung des Staatsexamensstudiengangs in Deutschland, keine Ansicht als „herrschend“ hervortritt, während bildungspolitisch nichts geschieht.
Kann eine „einfache“ Reformierung Abhilfe leisten? Die Frage, ob der Fachbereich Hoffnung auf Reformierung zulässt und wozu Letztere beitragen könnte, treibt wohl nicht nur uns zwei Studis der Rechtswissenschaften, um.
Von Emily Scholz und Shannon Bohacz
Who let the Law out?
Reformbestrebungen im als „Herrschaftswissenschaft“ bezeichneten Fachbereich sind wohl einerseits der DNA des Faches als Ordnungshüterin geschuldet. Zugleich ist sie Ort für “Streitkultur” in der demokratischen Gesellschaft: Ob es sich bei Jura um ein änderungsresistentes Relikt aus der Kreidezeit handelt, bleibt einmal dahingestellt.
Fest steht: Reformierung ist dringend nötig. Nicht nur steht durch Pensionierungswellen und abnehmende Studierenden-Zahlen das Demographie-Problem in der Rechtspflege im Raum. Seit jeher ist der Leistungsdruck im Jura-Studium ist geradezu berüchtigt: Die Staatsexamina bereiten Studierenden Bauchschmerzen, lange bevor sie in die Vorbereitungsphase eintreten. Hinzu kommt, dass das Studium wenig allgemeine Kompetenzen vermittelt. Ein Blick in andere Studiengänge zeigt, dass ein Studium in anderen Fachbereichen vielfältige und fachübergreifende Tätigkeiten eröffnet.
Der ewige Reformbedarf: Empirische Studien vs. Hemmung in der Bildungspolitik
Kritische Stimmen aus der Wissenschaft, u.a. die 2023 veröffentlichte bislang größte Studie iur.reform zeichnen ein trübes Bild:
Mittels Befragung von knapp 12.000 Jurist*innen kam das Bündnis zur Reform der Juristischen Ausbildung e.V. zu einem repräsentativen Ergebnis. Es wird “in allen Ausbildungsstationen und juristischen Tätigkeitsfeldern ein Reformbedarf wahrgenommen“. Reformvorschläge wurden in 43 Thesen kategorisiert und als Datenbasis für den anhaltenden Diskurs Entscheidungsträger*innen zur Verfügung gestellt.
Die Reduktion der Stoffmenge ist seit jeher eine Forderung. Eine Vereinheitlichung und Abschichtungder Abschlussprüfungen sowie bessere Betreuung von Studierenden kommen hinzu. Stimmen, die Maßnahmen zur Reduktion der psychischen Belastung fordern sind in letzter Zeit lauter geworden. Heißes Thema ist auch mehr Praxisnähe sowie der flächendeckend mögliche Erwerb des integrierten Bachelors (LL.B.).
Hohe Zustimmungswerte fanden auch die Vervielfältigung von Lehrformaten, Arbeit an der Rechtsdidaktik und Besserung der universitären Prüfungsvorbereitungen als Alternative zum kommerziellen Repetitorium. Dabei sollte aber durchaus ein Diskurs für weitere Reformen offenbleiben.
Obgleich ihrer deutlichen Ergebnisse – die Mehrheit sprach sich bereits 2022 für den Reformbedarf aus – hat die Empirie nicht an politische Entscheidungsträger*innen vordringen können. Vergangene Justizminister*innenkonferenzen zur Reform der juristischen Ausbildung (JuMiKo) bescheinigten zuletzt im Juni 2024 “keinen grundlegenden Reformbedarf”:
Maßnahmen wurden durch den zuständigen Koordinierungsausschuss für die Juristenausbildung (KoA), nicht wirklich in Betracht gezogen. Und das, obwohl es dem Arbeitsmarkt an Nachwuchs mangelt, den Universitäten an Studienabbrecher*innen hingegen nicht. Die Datenlage der erarbeiteten Beschlussvorlage des KoA, “anekdotische” Befunde aus 91 bundesweiten Interviews, wirkt im Vergleich zur vorgelegten iur.reform-Studie dürftig, geradezu willkürlich in der Auswertung.
Ein Aufschrei ging derweil durch die Medien. Unter dem Hashtag #iurserious wurde in sozialen Netzwerken Kritik am JuMiKo-Beschluss geäußert. Ferner ertönten Stimmen aus der Lehre, Forschung, Praxis sowie von Verbänden, die in einem offenen Brief an die 95. JuMiKo die Realitätsferne sowie Missachtung der vielfältigen vorliegenden Erhebungen anprangerten. Es wurde ein offener Prozess zwischen den zu beteiligenden Akteur*innen eingefordert und festgestellt, „der Beschluss der Justizministerkonferenz verkenn[e] die Zeichen der Zeit.
Prof. Dr. Ulla Gläßer, LL.M. (Viadrina Universität Frankfurt-Oder) demgegenüber plädiert beispielsweise für eine Reduktion der quantitativen Stoffmenge. Stattdessen sollte eine verpflichtende Gestaltung der Grundlagenfächer mit Anbindung an gegenwärtige politische Problemstellungen, gesellschaftliche Diskurse und die Realität und das Erleben der Studierenden erfolgen.
Staatsexamen oder Nichts?
Eine starke psychische Belastung aufgrund von Leistungsdruck ist unter Studierenden extrem normalisiert. Studierende in der Examensvorbereitung weisen eine besondere Belastung auf. Bei der Regensburger “JurSTRESS-Studie” zeigten 60 Prozent in der Examensvorbereitung chronische Stresssymptome. Insgesamt leiden Jura-Studierende überproportional an Angst, Stress wie Depressivität (48% der Befragten wiesen Zeichen einer Angststörung, knapp 19% Symptome einer Depression, im Kontext der juristischen Ausbildung auf). Jede*r unter uns hatte schon Mitstudierende, die sich in solchen Lagen befanden oder war schon einmal selbst betroffen.
Da die nicht bestandene Abschlussprüfung das Ende der juristischen “Karriere” bedeuten kann, wird sich auch nach anderen Wegen umgesehen. So nach dem integrierten Bachelor (LL.B.), der in Potsdam angeboten wird. Da andere Reformansätze kaum umgesetzt werden, bleibt dieser für Studierende als letzte Rettungsleine.
Und auch mit LL.B.-Abschluss kursieren Angst und Schrecken vor dem Staatsexamen (auch bekannt als “Endgegner”). Es ist also verständlich, dass weitere Reformen gefordert werden.
Für immer Jura(ssic) oder, JurEinheitsbrei
Wer sich für diesen Ausbildungsweg entscheidet, entscheidet sich, Jurist*in zu werden. Hierfür ist zunächst einmal rechtliches Fachwissen (“materielles Recht”) zu verinnerlichen und am “praktischen” Examensfall methodisch anzuwenden.
Dies soll auf die klassischen juristischen Berufe vorbereiten. Doch Kritik bleibt, dass das Studium auch hierfür zu praxisfern ist. Der in der Uni fast heilige Gutachtenstil findet im Berufsalltag der meisten Jurist*innen kaum Anwendung. Immerhin bietet der Arbeitsmarkt eine große Anzahl an Möglichkeiten für Volljurist*innen. Grund dafür sei es, dass Jurist*innen lernten, mit komplexen Sachverhalten umzugehen, detailorientiert zu arbeiten und Probleme systematisch kohärent zu lösen. Doch sind Jurist*innen wirklich Allrounder? Solche Aussagen treffen schließlich unter anderem auch auf Ingenieur*innen, Ärzt*innen oder Philosoph*innen zu.
Der KoA gestand in seinem Bericht 2011 zwar ein, dass “Rechtsdogmatik, Rechtslehre und praktische Rechtsanwendung auch das Wissen um die geschichtliche Herkunft, philosophische Begründbarkeit, Wirksamkeit und Umformung von Recht im Gemeinwesen” erfordern.
Die reglementierte Berufsform Jurist*in begründet sich aus Studierendensicht dennoch allein aus dem Umstand, dass einheitlich studiert wurde (“Einheitsjurist”). Ein Teufelskreis?
Natürlich bleibt es Personen überlassen, sich anderweitig, außerhalb des Pflichtstoffbereichs der Ersten Juristischen Prüfung zu qualifizieren. Beispielsweise können ehrenamtliches Engagement und Nebenjobs wichtige Kompetenzen, wie der, im Team zu arbeiten und sich in praktischer Solidarität zu üben, trainieren. Auch enthalten der Bachelor sowie Schwerpunktbereiche die Möglichkeit, etwas spezifischere Inhalte frei zu wählen.
Und dennoch: Ein derart umfangreiches Studium erfordert sozialen Rückhalt, Ausdauer und Privilegien. Darüber hinaus bleibt, angesichts der ausschließlichen Gutachtenprüfungen im Examen, das Qualitätsmerkmal der in den Staatsdienst eintretenden Berufsanwärter*innen, dieselbe Stoffmenge auswendig gelernt und bestmöglich entsprechend zumeist vertretener Ansichten an den richtigen Stellen platziert zu haben.
Auch wenn an der Uni zuweilen betont wird, es käme nicht auf das Ergebnis, sondern vielmehr den Lösungsweg an, ist doch die Korrektorin Herrin über das Korrekturverfahren, sowie den mitunter für Beleidigungen herhaltenden genau „sieben Zentimeter breiten Korrekturrand auf der linken Seite“. Doch das ist Thema für eine andere Diskussion.
Das „Do ut des“ im Klausurenjungle
Was hebt das Lösen von rechtlichen Problemen im juristischen Sachverhalt so sehr ab?
Es könnte sein, dass die endlosen (Probe-)Klausuren die Fähigkeit zum strukturierten Arbeiten vermitteln. Dabei werden Studierende indirekt dazu gezwungen, das eigene Zeitmanagement zu optimieren und eigenverantwortlich wie “dialektisch” problemsensibel vorzugehen.
Solche Fähigkeiten sind in jedem Beruf wichtig. Jedoch werden diese neben dem juristischen Fachwissen zu gesundheitsschädigenden und exkludierenden Bedingungen erworben. Inwiefern hier Resilienz, Frustrations- beziehungsweise Scheitertoleranz und Motivation fernab von Konkurrenzdenken entstehen sollen, bleibt bei dem Wettbewerb um das „Einsammeln von Punkten“ ein Rätsel.
Zwar lernen Jurist*innen, sich schnell und tiefgreifend in neue Fachgebiete einzuarbeiten, was erfordert, rechtsanalytisch über zu lösende Probleme argumentativ zu streiten.
Interdisziplinäre Themen und das Ausbilden von Forschungs- wie rhetorischen Fähigkeiten bleiben aber unterdessen Raritäten.
So scheint neben dem ehrwürdigen Professor*innen-Satz „Ein Blick ins Gesetz fördert die Rechtskenntnis!“ der Konsum des Prügungsstoffs universitärer Selbstzweck.
Ich lerne also bin ich?
„Lernen, lernen“ ist ein beliebtes Schlagwort in der allgemeinen Bildungspolitik. In Schulen und Universitäten liegt der Hauptfokus darauf, Fachwissen zu lehren. Nicht abzustreiten ist, dass für viele Berufe eben solches Wissen wichtig und auch ausschlaggebend sein kann.
Jedoch haben es sich unsere Bildungseinrichtungen auch zur Aufgabe gemacht, uns Studierende als „vollwertigeMitglieder der Gesellschaft“ auszubilden. Doch für die Förderung von Teilhabe und Verantwortungsübernahme braucht es mehr als nur Fachwissen.
Auch „Leben heißt lernen“ oder aus der Psychologie: ‘lebenslanges Lernen’ bedeutet nicht nur, aus Erfahrungen zu lernen. Sich selbst Wissen und Fähigkeiten anzueignen, sowie ein gewisses Maß an Vertrauen und kritischem Denken sind Schlüssel in Lebensbereichen wie zwischenmenschlichen Beziehungen, einer Berufslaufbahn und politischer Teilhabe.
Dies sollte auch ein Studium vermitteln. Egal, ob Jura, Geistes- oder Naturwissenschaften. Denn hieran scheitern viele Studiengänge: Jeder Studiengang produziert Absolvent*innen, die sich im Studium Mengen an Fachwissen aneignen, aber nicht notwendigerweise allgemeine akademische Arbeitsweisen oder den „Rechtsfrieden“ fördernde soziale wie emotionale Fähigkeiten erlernen. So fällt es auch eher wenigen Studierenden ein, interdisziplinär also fachübergreifend zu arbeiten oder zu forschen. Auch Geldprobleme und drängende Zeit lassen wenig Raum und Kapazität, sich über die notwendigen Studien-leistungen hinaus zu qualifizieren.
Reformen scheinen also in vielen Studiengängen wünschenswert. Wie genau sie aussehen sollten, können Studierende der Fachgebiete selbst formulieren. Jede*r von uns weiß wahrscheinlich am besten, woran es im eigenen Studiengang mangelt. Hoffentlich weisen auch zukünftige Justizminister*innenkonferenzen einen solchen lucidum intervallum (lichten Augenblick) auf, indem sie mit Blick in die Datenlage verkünden: „Es besteht grundlegender Reformbedarf“!