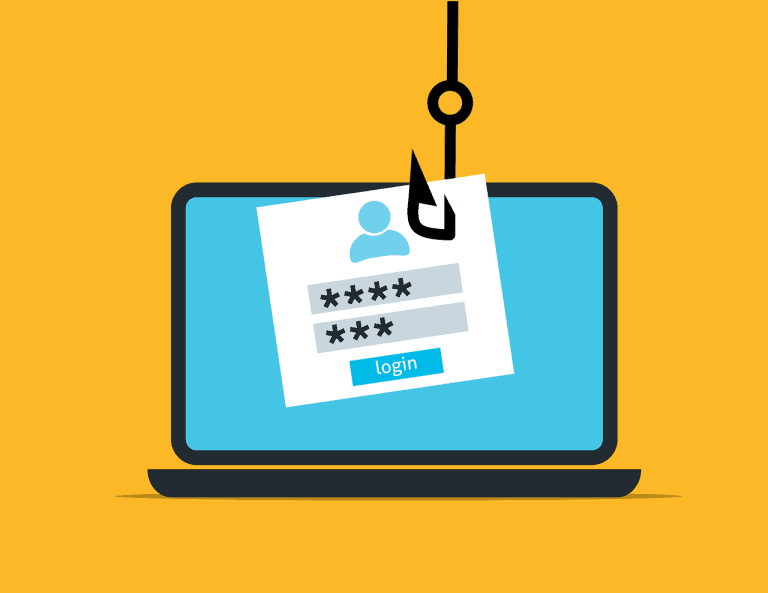Der Traum von der Moral: Werbung in Zeiten von Covid-19

Eine Zeit lang schien der Platz eng zu werden. An Wänden, auf Bildschirmen, in Zeitschriften, den Produkten selbst, in der U-Bahn, im Radio, den sozialen Medien, sogar auf Köpfen gedruckt – überall sieht man: Werbung. Aber etwas scheint passiert zu sein, während dem Lockdown und nach dem Mord an George Floyd und den darauf folgenden Protesten; während wir alle eigentlich was Besseres zu tun und vielleicht kein Geld mehr hatten, um uns um die Produkte der Werbung zu kümmern. Plötzlich scheinen viele Unternehmen mehr auf Menschlichkeit als auf Produkte zu setzen. Klingt ja eigentlich ganz gut, aber kann das wirklich sein? Von Nathan Hümpfner.
Egal wohin man den Kopf dreht, welche Erinnerungen man abruft – irgendwo ist immer Werbung. Der Zott-Sahne-Joghurt-Jingle verfolgt mich seit Jahrzehnten. Diese Flut ist natürlich Kalkül. Als durchschnittliche_r Verbraucher_in ist man jeden Tag mehreren Tausend, vielleicht sogar zehntausenden Werbeanzeigen ausgesetzt – man könnte also sagen, wir sind alle Expert_innen in Sachen Reklame. Aber abseits der Frage, warum es dann so viel schlechte Werbung gibt, war da in letzter Zeit etwas seltsam.
Produktlose Realitäten
Das hat natürlich auch etwas mit Covid-19 zu tun. Es ist unmöglich dem Ganzen zu entkommen – nicht nur die symbolischen Masken und die konstanten Nachrichten und erkrankte Verwandte und Bekannte erinnern daran, sondern eben auch Werbung. Aber statt uns, wie üblich, einen Traum zu verkaufen, passiert hier etwas anderes: Scheinbar konkurrierende Drogeriemärkte schließen sich plötzlich zusammen, um ihren Mitarbeiter_innen zu danken; andere Firmen lassen gar Plakate aufstellen, die niemand sehen soll; Versandhäuser sprechen uns Mut und Zuversicht zu; Amazon lobt sich selbst für seinen exzellenten Umgang mit seinen wahnsinnig glücklichen Angestellt_innen und Coca Cola lässt am Times Square in monumentalen Lettern verkünden: „Staying apart is the best way to stay united.“ Falls das ein Traum ist, ist es ein seltsamer – es scheint, als läge den Unternehmen mehr an Danksagungen und sozialer Verantwortung als an Verkaufszahlen.
Denn je mehr man sich von diesen emotionalen Kurzfilmen und Anzeigen ansieht, desto mehr fällt auf, dass hier etwas fehlt: Das Produkt. Dabei ist das doch der Zweck des Ganzen – Werbung basiert seit jeher auf einem gewissen gesellschaftlichen Neid, dass es da eine alternative Realität gibt, die unsere übertrumpft. Je monotoner die Gegenwart, desto aussichtsreicher muss unsere Vorstellung von der Zukunft sein. Diese schönen, glücklichen, erfolgreichen und begehrten Menschen: Das könnten wir sein – vorausgesetzt wir kaufen das Fußbad mit den anti-rutsch Noppen.
Der Traum vom Bedürfnis

Diese Träume basieren auf einem angenommenen gesellschaftlichen Normalzustand – auf einem gewissen Miteinander. In diesem sozialen Idealzustand teilen wir Fertigpizzen (völlig absurd) und fahren vom smart angelegten Geld mit der Familie in ein Land, das aussieht wie ein Windows 98-Bildschirmhintergrund. Aber wenn wir den Kontakt zu anderen verlieren, dann hilft es wenig diese Szenarien als Träume zu verkaufen, denn sie sind ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn die jetzige Realität schlechter ist als die alte, dann scheint es absurd und unerreichbar, die alte übertrumpfen zu wollen. Träume wollen ja erreichbar scheinen.
Vielleicht ist es also einfacher, den Kund_innen zu vermitteln, dass die alte, pandemielose Wirklichkeit der Nähe eigentlich der Traum war; dass das Unternehmen im Grunde gar nicht auf Geld aus ist, sondern sich um den Menschen an sich kümmert. All die leeren Slogans, Buzzwords und Floskeln – ebenso wie die Danksagungen, die vermeintliche Nähe zu den Kund_innen und letztlich die scheinbare „wokeness“ – machen genau das: Sie vermarkten die Fabel eines tröstenden, heilenden Unternehmens. Und das belohnt man doch gern mit Loyalität.
Ganz ehrlich: Es ist ja nicht so, als ob man sich das nicht insgeheim irgendwie wünscht.
Aber davon profitiert die Werbung, denn sie versucht, Bedürfnisse zu schaffen, wo keine sind. Hier ist jedoch tatsächlich ein Bedürfnis, das nicht erst geschaffen werden muss: Der Wunsch nach einer, naja, besseren Welt; in diesem Fall nach Firmen, die ihre Beschäftigten wegen besonderer Risiken besser bezahlen, vielleicht bessere Arbeitsverhältnisse schaffen; die sich nicht nur gegen Rassismus und für ein Miteinander aussprechen, um noch schnell auf den fahrenden Zug aufzuspringen. Mit anderen Worten: Unternehmen, die seltsam sozialistisch sind.
Unternehmen als Produkt?
Sicher, es ist gut, wenn große Unternehmen sich gegen Rassismus aussprechen und ihren Mitarbeiter_innen dankbar sind. Aber das ist oft das absolute Minimum und weit weg von wirklich einschneidenden Taten und langfristigen Veränderungen. Zu diesen sind die Unternehmen natürlich nicht bereit, denn es lohnt sich ja nicht. Soziale Verantwortung läuft nur, solange es auch wirtschaftlich ist. Und mehr als das absolute Minimum braucht es eben nicht, um den Anschein zu geben, dass diese Themen wirklich wichtig sind. Natürlich darf man als Unternehmen hier nicht vergessen hinzuzufügen, dass das schon immer so war – hat man halt leider damals nicht gesagt.
Die tausenden Werbeanzeigen, die uns täglich begegnen, sollten uns eigentlich einen gesunden Zweifel den Botschaften der Werbung gegenüber gelehrt haben. Zumindest genug, um zu wissen, dass die Werbung heute das mit Unternehmen tut, was sie früher mit deren Produkten getan hat: Uns einen Traum verkaufen. Und irgendwie glauben wir diesen ganz gern.