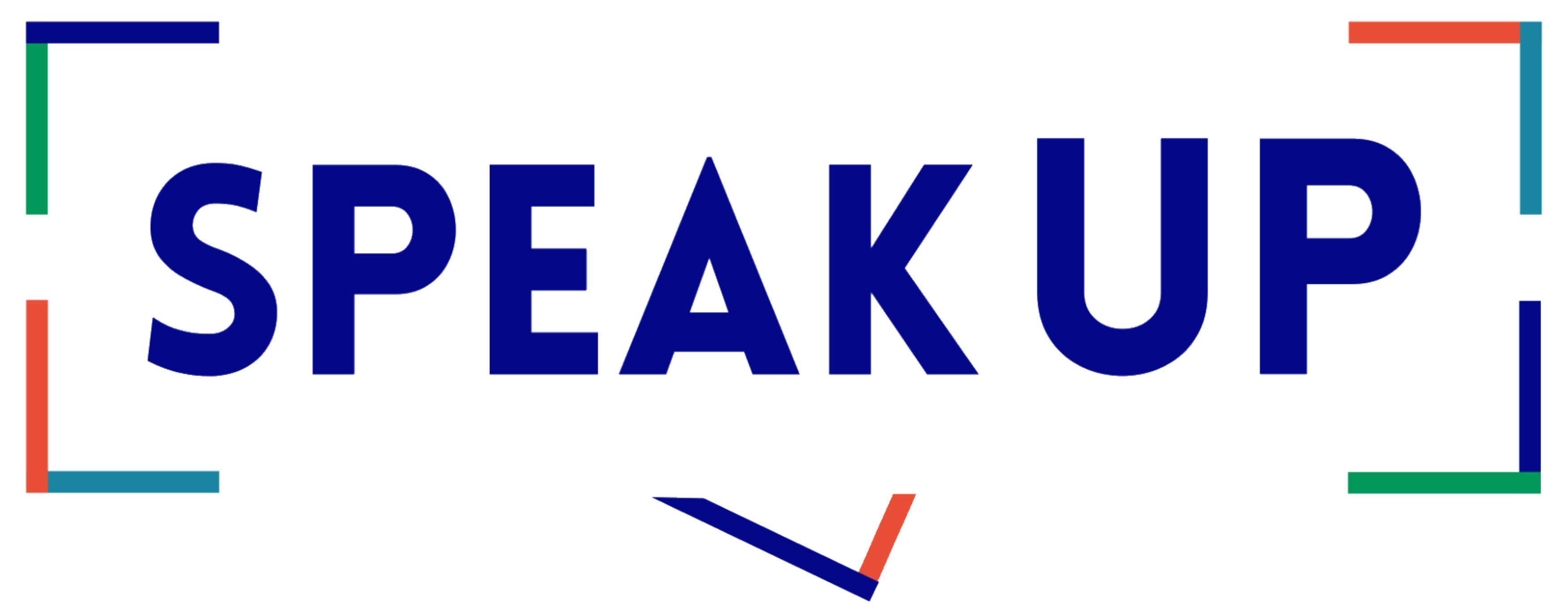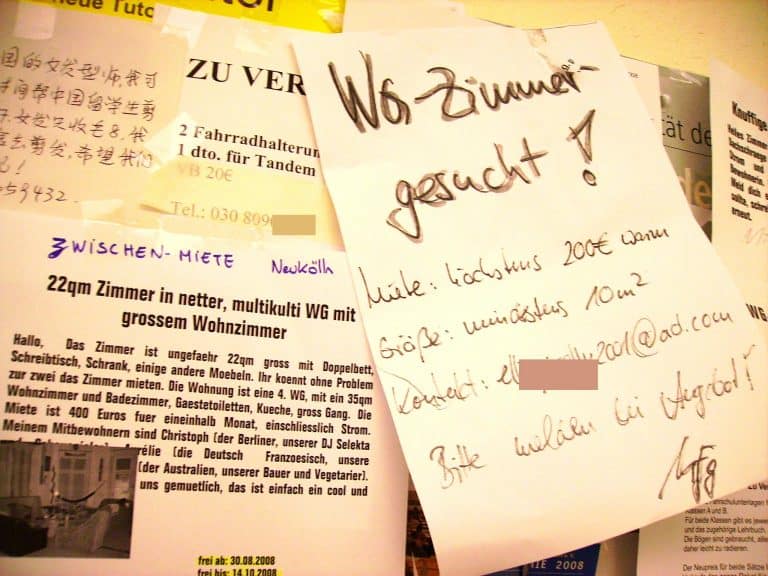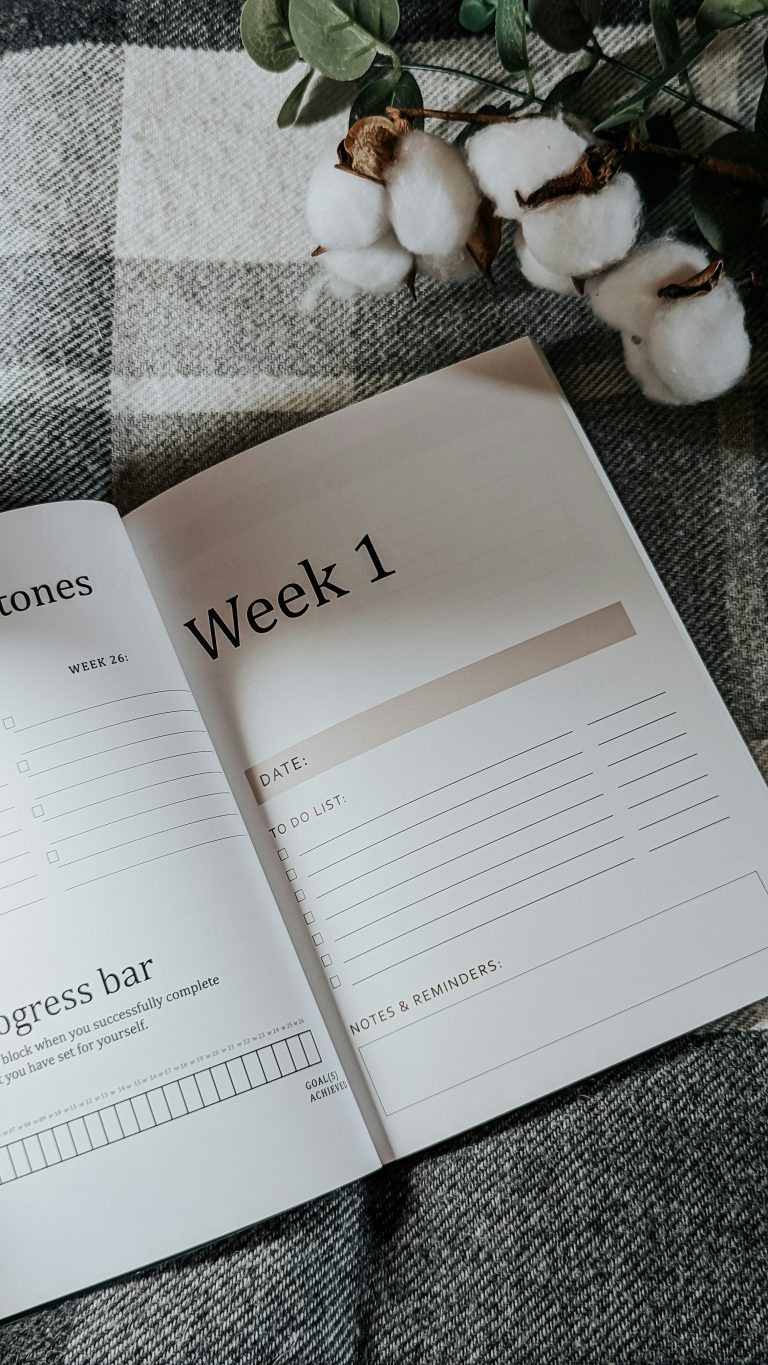Brauhausberg: Der vierte Campus nimmt Form an – ein Mammutprojekt zwischen Mäzenatentum und Gemeinwohl
Die Universität Potsdam plant einen weiteren Campus auf dem Brauhausberg in der Innenstadt. Finanziert wird das Bauprojekt von der Hasso-Plattner-Stiftung, die im Gegenzug den Campus Griebnitzsee übernehmen soll.
Seit der Pressekonferenz am 2. Juni 2025, auf der Uni und Stiftung ihre Pläne präsentierten, wird heftig diskutiert. Während die Verantwortlichen das Vorhaben als großen Gewinn darstellen, kommt aus Teilen der Stadtgesellschaft scharfe Kritik. Auf der Seite “Potsdam – Stadt für alle” ist unter der Überschrift “Vergiftete Geschenke” von einer drohenden Privatisierung öffentlichen Landes die Rede – man müsse sich fragen, ob “sich da ein Superreicher seine eigene Privatstadt baut”. Auch viele Studierende, vor allem aus den Fakultäten, die den Griebnitzsee verlassen sollen, sind verunsichert: Was passiert mit den Wohnheimplätzen am Griebnitzsee? Wie wird der neue Campus aussehen? Und warum kooperiert die Uni mit der Hasso-Plattner-Stiftung?
Am 23. Juli 2025 haben wir in einem Interview mit dem Uni-Präsidenten Oliver Günther und Kanzler Hendrik Woithe über diese Fragen gesprochen. Welche Antworten sie gaben – und was weiterhin offen bleibt – könnt ihr in diesem Bericht lesen!
Lest hier unseren Artikel über die Pressekonferenz für Hintergrundinformationen.
Nochmal von Anfang an:
Uni-Präsident Oliver Günther betont im Gespräch, dass die Pressekonferenz nur wenige Wochen nach Beginn der Überlegungen zu einem neuen Campus stattfand. Zunächst habe man in einem “kleinen Kreis” diskutiert, wie sich der wachsende Platzbedarf am Griebnitzsee decken lasse, wo es inzwischen “ein bisschen eng geworden” sei. Dort ist auch die Digital Engineering Fakultät (DEF) angesiedelt, die von der Uni und dem Hasso-Plattner-Institut gemeinsam getragen wird. Sie umfasst momentan rund 1.000 Studierende und solle mit der geplanten Erweiterung doppelt so groß werden. Hinzu kämen die 6.000 Studierenden aus der Juristischen, sowie der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät. Für diese Dimensionen gebe es am Griebnitzsee keinen Platz. Relativ schnell sei daher klar gewesen, dass der Brauhausberg eine interessante Option für einen vierten Campus darstellen könnte.
Diese Möglichkeit sei intensiv abgewogen worden, räumt Günther ein: „Ein vierter Campus ist nicht automatisch besser.“ Mehr Standorte bedeuten zusätzlichen Aufwand bei Infrastruktur, Verwaltung und Mobilität. „Aber die Chance, mitten in die Landeshauptstadt zu gehen, konnten und wollen wir nicht ignorieren.“
Der derzeitige Plan sieht vor, dass die Hasso-Plattner-Stiftung den Campus Griebnitzsee vom Land Brandenburg erwirbt und im Gegenzug das Gelände am Brauhausberg von einem privaten Investor kauft. Sie soll des Weiteren die Bebauung des Brauhausberg finanzieren und der Universität Potsdam anschließend einen„schlüsselfertigen“ Campus schenken.
Die Finanzierung und die Frage um das Mäzenatentum in Potsdam:
In der Pressekonferenz wurde diese Konstellation als eine “Public-Private-Partnership”, eine “Win-Win” Situation für alle Beteiligten präsentiert. Doch wie reagieren Günther und Woithe auf die Kritik, etwa von “Potsdam – Stadt für alle”?
Günther verweist auf die strukturellen Probleme im Hochschulbau: Obwohl “Deutschland kein armes Land” sei, dauere vieles zu lange. Als Beleg legt er die Baupläne für den Campus Neues Palais von 2013 auf den Tisch,die bis heute nicht umgesetzt sind. Vor diesem Hintergrund sei es “unverantwortlich, diese Bereitschaft [von Hasso Plattner] dem Gemeinwohl zu dienen, nicht anzuerkennen”. Woithe ergänzt, dass es sich bei der Stiftung um eine gemeinnützige Einrichtung handle. Zudem bekenne sich Herr Plattner explizit zur Idee einer gemeinsamen Fakultät im Verbund mit einer staatlichen Hochschule. Dies sei eine einmalige Chance, die man nicht verstreichen lassen dürfe.
Beide betonen zudem, dass auch die Verkaufserlöse des Campus Griebnitzsee allen Standorten zugutekommen sollen. Geplant sind Investitionen am Neuen Palais sowie der Bau eines großen Laborgebäudes in Golm.
Günther macht keinen Hehl daraus, dass ein Projekt dieser Größenordnung nicht ohne Einfluss des Geldgebers ablaufe: „Natürlich hat ein Mensch, der so etwas baut, auch Mitspracherecht bei der Ausgestaltung. Alles andere finde ich auch nicht richtig.“ Entscheidend sei, ein „gutes Maß“ zwischen den Vorstellungen der Stiftung und den Interessen der Universität und damit dem Gemeinwohl zu finden. Er fügt hinzu: „Ich bin ja bekanntlich Sozialdemokrat, insofern können Sie mir schon glauben, dass ich mir das mit dem Gemeinwohl genau überlege.“
Unsere Nachfrage, ob eine solches Mitspracherecht, die Freiheit der Lehre beeinträchtigen würde, verneinen sowohl Präsident wie auch Kanzler entschieden. Günther betont erneut, die Universität habe bei dieser “glückliche[n] Konstellation” zugreifen müssen – die Freiheit von Forschung und Lehre sei davon nicht berührt. Auch die Professuren der DEF würden trotz privater Finanzierung der öffentlichen Qualitätskontrolle unterliegen.
Die Taskforce
Das Projekt wird mit Hochdruck vorangetrieben. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Taskforce, in der Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, mehrere Minister:innen, Vertreter:innen der Landeshauptstadt, die Universitätsleitung und die Hasso-Plattner-Stiftung zusammenarbeiten. Dort seien die Grundzüge der Kooperation festgelegt worden – von der Finanzierung bis zu den baulichen Zielen.
Unter der Taskforce arbeiten mehrere Arbeitsgruppen. Günther vertritt die Uni in der AG „Kooperationen in Forschung und Lehre“, Woithe arbeitet in der AG „Planung und Bauen“. Diese wiederum haben weitere Untergruppen eingerichtet, etwa zu Liegenschaftsfragen, zur Planung am Brauhausberg, zu Golm und zum Neuen Palais. Eine erste zentrale Aufgabe für die UP ist die Erarbeitung eines sogenanntes Raumbuch, dasden Flächenbedarf und die Nutzung von Hörsälen, Seminarräumen, Büros und Lernlandschaften detailliertbeschreibt.
Wohnen am Griebnitzsee und Brauhausberg
Studierende befürchten, dass der neue Campus nicht ausreichen könnte, um alle bisherigen Einrichtungen vom Griebnitzsee aufzunehmen. Kanzler Woithe widerspricht:
„Wir verlagern den Campus [komplett] da rüber. Ich rechne sogar mit einem kleinen Flächenplus.“ Zwar müsse der Bebauungsplan noch Naturschutz- und Anrainerfragen berücksichtigen, doch erste Gespräche mit der Stadt stimmten ihn optimistisch. Nur eines sei klar: 1.000 zusätzliche Wohnheimplätze ließen sich am Brauhausberg nicht mehr realisieren. „Aber was wir vom Kern her brauchen, passt hin.“
Gerade die Wohnheime sind für viele Studierende ein zentrales Thema. Wer künftig Eigentümer und Betreiberder Gebäude am Griebnitzsee sein wird, liege nicht in der Hand der Universität. „Das wird direkt verhandelt zwischen Land, Studierendenwerk und Hasso-Plattner-Stiftung“, erklärt Günther. Die Position der Universität sei jedoch eindeutig: Es müsse eine Durchmischung geben, um ein „Informatikerghetto“ zu vermeiden. Sollten Wohnheimplätze am Griebnitzsee aus dem öffentlichen Zugriff entzogen werden, müsse im Gegenzug Ersatz geschaffen werden. Günther betont zudem, dass auch am Brauhausberg zusätzliche Plätze wünschenswert wären, obwohl dies räumlich wie finanziell schwierig sei.
Woithe verweist auf laufende Projekte: In Golm sollen 400 neuen Plätze entstehen, weitere Wohnheime könnten in der Innenstadt hinzukommen. Damit ließe sich die Wohnheimquote von derzeit zehn auf etwa 15 Prozent steigern. „Das ist eine Verbesserung“, räumt er ein, „aber noch immer weit entfernt von dem, wo wir eigentlich hinwollen.“
Auf Nachfrage beim Studierendenwerk betont dieses, dass die Wohnheime auf dem Campus Griebnitzseenicht Teil der am 2. Juni 2025 veröffentlichten Absichtserklärung zwischen Land, Universität und Hasso-Plattner-Foundation seien. Das Studierendenwerk befinde sich derzeit im Austausch mit der Stiftung zur Zukunft der Wohnheime, wobei ein Verlust von Plätzen ausgeschlossen werde. Parallel liefen Neubauprojekte in Golm, Potsdamer Mitte und Bornstedter Feld, um zusätzliche studentische Unterkünfte zu schaffen, wobei die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum weiterhin eine große Herausforderung bleibe.
Frage der öffentlichen Ausschreibung
Oft wird gefragt, ob der Verkauf des Campus Griebnitzsee nicht europaweit hätte ausgeschrieben werden müssen. Dazu erklären Günther und Woithe, dass dies allein in der Zuständigkeit des Landes liege: „Das liegt im Landesvermögen. Das Land regelt den Verkauf.“ Woithe selbst zeigt sich unbesorgt: „Es ist im Interesse aller Beteiligten, dass dies juristisch sauber abgewickelt wird.“
Barrierefreiheit und Mobilität
Ein weiteres zentrales Thema ist die Erreichbarkeit des Brauhausbergs. Die Nähe zum Hauptbahnhof gilt alsVorteil, der steile Aufstieg bleibt jedoch eine Herausforderung – vor allem für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. „Der neue Campus muss barrierearm, bestenfalls barrierefrei sein“, betont Kanzler Woithe. Derzeit fährt die Buslinie 691 in die Nähe des Geländes, doch das reiche nicht aus. Diskutiert würden zusätzliche Busse, autonome Shuttle-Fahrzeuge oder als besonders innovative Lösung, die auch den zu erwartenden Nutzerzahlen gerecht würde, eine Seilbahn mit Zwischenstopp am Museum Das Minsk. Entscheidend sei, so Woithe, dass alle Studierenden und Mitarbeitenden mit Einschränkungen einen möglichst einfachen Zugang erhalten. Die konkrete Verkehrsanbindung liege allerdings bei der Stadt und sei Teil des Bebauungsplans.
Studentische Beteiligung
In Gesprächen mit der Studierendenschaft fällt ein Punkt immer wieder: die Frage nach Mitbestimmung. Vor allem Studierende der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät haben den Eindruck, dass die Jurist:innenstärker in den Prozess eingebunden sind, während ihre eigenen Interessen weniger Gewicht bekommen.
Präsident Günther verweist hier auf die bestehenden Strukturen: Ansprechpartner:innen seien zunächst die Dekan:innen, die über das weitere Vorgehen innerhalb der Fakultäten entschieden. Wenn Studierende der großen Fakultäten eine AG zum Projekt Brauhausberg gründen und dies mit den Dekan:innen abstimmen, sei eine Einbindung möglich, dies sei von der Hochschulleitung auch explizit gewünscht. Kanzler Woithe kündigt zudem konkrete Beteiligungsformate an. Mit benannten Professor:innen aus beiden Fakultäten werde es Workshops geben – erste Termine im August, weitere im Oktober – bei denen auch Studierende mitarbeiten können. Zwar sei die Zahl begrenzt („zwei oder drei Interessierte sind realistisch“), doch als erste Adressen nannte er den AStA und die Fachschaftsräte. Auch eigeninitiatives Engagement sei willkommen: Wer mit guten Ideen an die Fakultätsleitungen herantrete, stoße auf offene Ohren. „Aber der Grill kann nicht so groß sein, dass wir jede Extrawurst drauf braten können“, schränkt er ein.
Beide betonen, dass es nicht darum gehe, Studierende außen vor zu halten, sondern möglichst viele kreative Impulse in kurzer Zeit zu sammeln. Dabei gehe es nicht nur um Zahlen und Flächen, sondern auch um Visionen, wie Günther hervorhebt: „Das, was wir da bauen, steht in hundert Jahren noch. Wie könnte dann ein Jurastudium oder ein WiSo- Studium aussehen?“
Aus unserem Gespräch mit Kanzler und Präsident entstand die Idee, durch einen Ideenwettbewerb einen zusätzlichen Impuls für mehr studentische Beteiligung zu geben. Diesen Wettbewerb organisierten wir von derSpeakUP gemeinsam mit dem AStA, dem StuPa und dem Kanzlerbüro. In diesem Format hatten Studierende die Möglichkeit konkrete Vorschläge für die Gestaltung des Brauhausberges, Infrastruktur und Campusleben einzubringen. Die Gewinneridee orientiert sich an der Gestaltung der Victoria University of Wellington und schlägt einen zentralen „Hub“ für Studium, Austausch und Erholung auf dem neuen Campus vor.
Ausblick
Für viele Studierende ist besonders die Übergangszeit entscheidend: Werden Lehrveranstaltungen jahrelang in Containern stattfinden, wie es an anderen Hochschulen bei Großprojekten üblich war? Präsident Günther winkt ab: „Nein, wir haben ja keine Verdrängung.“ Umgezogen werde erst, wenn der neue Campus fertig sei. Woithe ergänzt: „Schlüsselfertig. Wir machen keine Teilumzüge.“ Der Umzug solle gebündelt stattfinden, „wahrscheinlich in Semesterferien“ – dann hieße es „einmal Kofferpacken“, von Büros über Seminarräume biszu Kartons.
Die zeitlichen Prognosen bleiben unsicher. Günther bezeichnet sich selbst als „unerschütterlicher Optimist“ und spricht von fünf Jahren Bauzeit, konservative Schätzungen gehen auch von bis zu zehn Jahren aus. In jedem Fall werde die Universität die bestehenden Gebäude am Griebnitzsee weiter nutzen und notwendige Sanierungen durchführen, abgestimmt mit der Stiftung, um Doppelarbeit zu vermeiden.
Die Zusammenarbeit mit der Hasso-Plattner-Stiftung beschreibt Woithe als „partnerschaftlich und produktiv“. Viele Akteure seien beteiligt – Ministerien, Stadt, Stiftung, Universität – und alle arbeiteten daran, schneller Ergebnisse zu erzielen. Ein Bebauungsplan dieser Größe dauere normalerweisedrei bis fünf Jahre; hier soll er in zwei Jahren umgesetzt werden. Dafür müssten alle Beteiligten „out of the box“denken, ohne Rechtskonformität zu vernachlässigen.
Konkrete Zahlen zu Verkauf, Umbau und Ausbau konnten Günther und Woithe nicht nennen. Hier sei man auf die Angaben der Stiftung aus der Pressekonferenz im Juni angewiesen: „Was immer uns das kosten wird, die Stiftung kann das finanzieren.“
Im Gespräch wurde deutlich: Kanzler Woithe und Präsident Günther verteidigen das Projekt engagiert und wirken fest von dessen Zielen überzeugt.