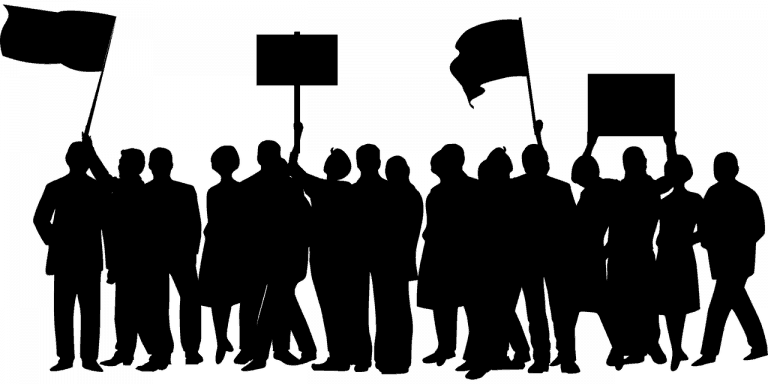Frontalangriff auf Links von links – Buchrezension Sahra Wagenknechts „Die Selbstgerechten“

Sahra Wagenknecht schlägt wieder um sich! Diesmal trifft es den sogenannten „Linksliberalismus“. Unser Redakteur hat sich durch das Buch gearbeitet und möchte nun seine Meinung kundtun. Von Maximilian Schulz.
Einführung – die Wagenknecht-Kontroverse
Zu behaupten, dass Sahra Wagenknecht eine kontroverse Politikerin ist, wäre eine Untertreibung. Immer wieder greift sie direkt oder indirekt die deutschen linken Parteien an und sorgt mit so manchen Aussagen für Furore. Ihr neuestes Buch „Die Selbstgerechten – Mein Gegenprogramm für Gemeinsinn und Zusammenhalt“ (345 Seiten), herausgegeben vom Campus Verlag, ist da keine Ausnahme. Und was für Wellen dieses Politikbuch doch verursacht hat!
Schuld daran ist vor allem der erste Teil, wo Frau Wagenknecht einen heftigen, polemischen Frontalangriff gegen die sogenannten „Lifestyle-Linken“ (eher Grüne) führt. Natürlich ließ die vorhersehbare Reaktion nicht lange auf sich warten. Neben Beifall von Konservativen und Reaktionären, hagelte es wüste Beschimpfungen von linker Seite: Sahra Wagenknecht sei eine Rassistin, eine AfDlerin im roten Gewand, eine erzkonservative Anti-Progressive, eine altkommunistische Hetzerin und so weiter und so fort. Doch stimmt das wirklich? Ist das Buch ein reaktionäres Manifest, gleichzusetzen mit Höckes Kampfschrift „Nie zweimal in denselben Fluß“ oder den „Turner Diaries“? Oder steckt doch ein Körnchen Wahrheit in den kritischen Worten Wagenknechts?
In der folgenden Buchrezension werde ich auf die für mich interessantesten Stellen des Werkes eingehen und meine persönliche Meinung dazu geben. Würde ich das gesamte Buch einer Analyse unterziehen, würden wir wahrscheinlich noch bis zum nächsten Sommersemester hier sitzen und diesen Artikel lesen, weshalb ich mich auf drei Kapitel begrenze.
Aber bevor wir über den Inhalt sprechen, reden wir ein wenig über die Autorin.
Sahra Wagenknecht – kontrovers, populistisch, links
Sahra Wagenknecht ist, neben Gregor Gysi, die vielleicht bekannteste deutsche Linke. Doch dieser Ruhm ist nicht nur positiver Natur, zieht doch Wagenknecht immer wieder den Ärger ihrer eigenen Partei auf sich und erzeugt ständig neue Kontroversen mit ihren Aussagen, die ihr oftmals Interviews mit reaktionären und konservativen Medien, wie der BILD und der WELT (also dem Springer-Verlag), einbringen. Bei ihrem neuesten Buch ist das nicht anders. Aber zuerst ein paar Hintergrundinformationen:
Sahra Wagenknecht wurde am 16. Juli 1969 in Jena, im Bezirk Gera der ehemaligen DDR, geboren. In den frühen 1990er Jahren saß sie in verschiedenen Vorstandsgremien der PDS, nach der Fusion mit der WASG wuchs ihr Einfluss auch in der Nachfolgepartei Die Linke. In ihr war sie Mitglied des linken Parteiflügels. Sahra Wagenknecht ist nicht nur Parteimitglied sondern auch Mitglied bei der Gewerkschaft ver.di.
Von 2010 bis 2014 war sie Stellvertretende Parteivorsitzende, von 2015 bis 2019 Vorsitzende der Linksfraktion. Davor war sie von 2004 bis 2009 Mandatsträgerin im Europäischen Parlament für die PDS bzw. Die Linke.
Sahra Wagenknecht ist zusätzlich auch eine promovierte Volkswirtin und Publizistin. Sie schrieb unter anderem die Bücher „The Limits of Choice“, „Die Mythen der Modernisierer“ (2001),„Freiheit statt Kapitalismus“ (2012) und „Reichtum ohne Gier“ (2016/18).
Die interessantesten Stellen des Buches
Das Vorwort
Im Vorwort kritisiert Sahra Wagenknecht, dass das Meinungsklima völlig vergiftet sei: Andersdenkenden werde gar nicht mehr zugehört, jede:r werde gleich als Rechte:r, Verschwörungstheoretiker:in, Nazi oder Klimawandelleugner:in bezeichnet, sobald er:sie nur eine andere Position als der Mainstream einnehme. Sie sieht sie die Schuld an der toxischen Debattenkultur nur zum Teil bei den erstarkenden Rechten, doch den Boden hätten zum einen die Neoliberalen mit ihrer ökonomischen Ungleichheit und dem Sozialabbau und die linken und sozialdemokratischen Parteien, die diese kulturell und politisch unterstützt hätten, bereitet. Insbesondere die sogenannten „Linksliberalen“ seien Schuld an der Situation.
Sie definiert auch gleich, was „linksliberal“ bedeutet: Es sei nämlich weder „links“ noch „liberal“. „Linksliberale“ seien das komplette Gegenteil von dem, was ihr Name verspricht. Sie seien intolerant gegenüber Quoten und Diversity, also der „ungleichen Behandlung unterschiedlicher Gruppen“ (Wagenknecht 2021, 12), sie interessieren sich nicht mehr für Gerechtigkeit dem Proletariat oder den sozialen Schwachen gegenüber, ihre soziale Basis liege stattdessen in der großstädtisch-akademischen Mittelschicht.
Sahra Wagenknecht wendet die klassische Hufeisentheorie an. Der „Linksliberale“ sei illiberal, intolerant und teile die Welt in ein schwarz-weißes Bild; eigentlich sind „Linksliberale“ genau das, was sie vermeintlich kritisieren: Rechte. „Rechts“ ist übrigens für die Autorin „die Befürwortung von Krieg, Sozialabbau und großer Ungleichheit“ (Seite 14), was an sich schon eine ziemlich fragwürdige Definition ist.
Laut Wagenknecht gehen „Linksliberale“ und Rechte eine symbiotische Beziehung ein, in dem sich die beiden gegenseitig brauchen, verstärken und von einander leben. Jede Hassrede der Rechten werde mit dem Hypermoralismus der „Linksliberalen“ quittiert, auf jeden Hypermoralismus antworte die Rechte mit Hassreden. So einfach ist die Welt für Sahra Wagenknecht.
„Moralisten ohne Mitgefühl“
Im ersten Kapitel ihres Buches rekapituliert Sahra Wagenknecht die großen Ereignisse, die (ihrer Meinung nach) das Jahr 2020 geprägt haben. Den Anfang macht die Rassismusdebatte um den Begriff „Zigeunersauce“, der auf Druck „linksliberaler“ Aktivist:innen zu „Paprikasauce Ungarische Art“ umgeändert wurde. Ähnlich verkehrten die „Linksliberalen“ mit der Personalchefin von Adidas, Karen Parkin, die zurücktreten musste, weil sie sich nicht genug um das Thema Rassismus und Diversity gekümmert hatte. Sarah Wagenknecht bemängelt, dass es den Aktivist:innen ziemlich egal sei, dass Adidas oder Unilever ihre Mitarbeiter:innen schlecht bezahlen, ihnen miese Tarifverträge aufzwingen und dass die Arbeitsbedingungen der asiatischen Zulieferer scheußlich sind.
Ihr nächster Punkt behandelt die George-Floyd-Proteste im Frühsommer 2020, die wahre „Bilderstürme“ auf Statuen von Kolonialisten und Sklavenhaltern in Nordamerika und Europa ausgelöst haben. Wer hätte gedacht, dass PoCs diese Personen als negativ sehen und diese „Denkmäler“ nicht mehr in ihrer Umgebung haben wollen?
Sie spricht auch einen Artikel der taz an, in dem eine Kolumnistin forderte, die Polizeibehörde ganz aufzulösen und die Verbeamteten „auf Mülldeponien zu entsorgen“ (Wagenknecht 2021, 23). Hier muss ich Frau Wagenknecht zur Seite springen. Der ständige Generalverdacht unter den Linke unsere Polizeibeamte und -beamtinnen stellen, ist alles andere als hilfreich. Polizist:innen leiden unter zu geringer Bezahlung, zu hohen Arbeitsstunden und extremsten psychologischen Belastungen. Da ist es nicht förderlich, pausenlos „ACAB“ zu brüllen oder jede:n Polizist:in als „Bullenschwein“ zu bezeichnen. Klar gibt es Rechtsextreme in der Beamtenschaft und natürlich gibt es systemische Probleme innerhalb der Polizei, aber deswegen ist noch lange nicht jede:r einzelne, individuelle Polizist:in ein:e Faschist:in. Und die Probleme lassen sich auch nicht lösen, indem man Beamte und Beamtinnen beleidigt oder angreift oder tot prügelt oder ihre Familien bedroht – da erreicht man eher das Gegenteil.
Im nächsten Punkt spricht Wagenknecht darüber, was eigentlich eine „traditionelle Linke“ ausmacht. Für sie bedeutet das: „das Streben nach mehr Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit, […] für Widerständigkeit, für das Aufbegehren gegen die oberen Zehntausend und das Engagement für all diejenigen, die in keiner wohlhabenden Familie aufgewachsen waren und sich mit harter, oft wenig inspirierter Arbeit ihren Lebensunterhalt verdienen mussten“ (Seite 23).
Die linken Parteien, dabei sei es egal ob sozialdemokratisch, sozialistisch oder kommunistisch, vertraten nicht die Elite, sondern die Unterprivilegierten. Ihre Aktivist:innen stammten auch aus diesem Milieu, was allerdings nur halb richtig ist. Viele der großen Wortführer:innen und Vorreiter:innen der Linken kamen aus akademischen oder wohlhabenden Verhältnissen, seien es nun Marx, Engels, Trotzki, Lenin, Rosa Luxemburg, Wilhelm und Karl Liebknecht, Kropotkin, Bakunin oder Martin Luther King Jr.
Nach Sahra Wagenknechts Meinung gibt es „traditionelle Linke“ noch, meistens finde man sie auf den unteren Ebenen von Gewerkschaften. In den Medien und an den Universitäten seien sie jedoch eine wahre Rarität. Dort sowie in den meisten linken Gruppen und Parteien haben die „Linksliberalen“ den größten Einfluss.
Danach charakterisiert Wagenknecht die „Linksliberalen“ etwas mehr, sie gibt ihnen den sehr kreativen Namen „Lifestyle-Linke“. Der oder die „Lifestyle-Linke“ unterscheidet sich vom „traditionellen Linken“ dadurch, dass er oder sie nicht mehr soziale oder politökonomische Probleme im Mittelpunkt stellt, sondern Fragen der Konsumgewohnheiten, des Lebensstils und moralischen Haltungsnoten. Am besten verkörpert wird der oder die „Lifestyle-Linke“ durch die grünen Parteien.
Der oder die „Lifestyle-Linke“ ist vieles, er oder sie ist weltoffen, pro-europäisch, sorgt sich um das Klima, setzt sich für sexuelle Minderheiten, Emanzipation und Zuwanderung ein. Er oder sie ist Weltbürger:in und anti-nationalistisch eingestellt. Er oder sie unternimmt selbstverständlich Auslandssemester oder Auslandspraktika. Alles wird vom Vermögen der Eltern bezahlt; Fleiß, Anstrengung, Leistung, Tradition und Gemeinschaft sind „uncool“ und so weiter und so fort geht die endlose Polemik.
Besonders interessant wird es, wenn Sahra Wagenknecht über „Gendersternchen“ und „Triggerwörter“ schreibt. Da der oder die „Lifestyle-Linke“ sich nicht mehr für Löhne, Renten, Steuern und Arbeitslosenversicherung interessiert, müssen neue Betätigungsfelder her, nämlich: die Sprache. Da werden plötzlich neue Wörter erfunden wie „Misogynie“ (das ist übrigens Frauenhass),„Cis-Frauen“ (es gibt übrigens auch „Cis-Männer“, Frau Wagenknecht) und natürlich das böse „Gendern“.
Ich bin ehrlich, ich bin kein großer Freund des Genderns, ich halte das für Symbolpolitik, für Scheinlösungen und Scheindebatten, die den Status quo aufrecht erhalten sollen. Statt über Schutzräume, bessere medizinische Versorgung, bessere rechtliche Unterstützung und den Abbau bürokratischer Hürden für LGBTQIA+-Personen und Frauen zu sprechen, diskutiert man lieber, ob man nun das Gendersternchen, den Unterstrich, den Bindestrich oder den Doppelpunkt verwendet. Diese endlosen Debatten lenken von wirklichen Problemen ab. Nur weil man an fast jedes Substantiv „:innen“ anhängt, wird es sich nicht ändern, dass LGBTQIA+-Personen Gefahr laufen, auf offener Straße gelyncht zu werden, provokativ gesagt.
Auch halte ich nichts von Begriffen wie „Person mit Penis“ oder „Person mit Vagina“, ich finde, dass das eine sehr entmenschlichende und bürokratisierte Sprache ist, die Menschen auf ihre Fortpflanzungsorgane reduziert. Und das sage ich als non-binäre Person. Ich finde auch die extremeren Elemente der „Identitätspolitik“ sehr besorgniserregend, besonders wenn quasi Segregation gefordert wird, alle weißen Personen als das „ultimative Böse“ bzw. „Brut Satans“ dargestellt oder Cis-Männer (egal ob nun hetero- oder homosexuell) als „Schweine“ betitelt und ihre Probleme (Gewalt in der Ehe, Missbrauch in der Kindes- und Jugendzeit, Depressionen, etc.) als nicht debattierwürdig betrachtet werden.
Doch das Einzige, was noch nerviger als „IdPol“ (Identitätspolitik) selbst ist, sind völlig von dem Thema besessene „Anti-IdPoler:innen“, zu denen auch Sahra Wagenknecht gehört, die behauptet, dass die „linksliberale“ Gendertheorie die Existenz biologischer Geschlechter verneint, was selbstredend Schwachsinn ist. Sie scheint auch nicht viel von der Finanzierung von Gender Studies zu halten, so viel zum Thema freie Debattenkultur und Freiheit der Forschung.
Danach kommt wieder endlose Polemik über die „Lifestyle-Linken“ (Cancel Culture, herablassende Bezeichnungen, Universitätsstädte, usw.), aber im Gegensatz zu Sahra Wagenknecht, werde ich mich an dieser Stelle nicht wiederholen.
Sahra Wagenknechts Programm
Im zweiten Teil ihres Buches liefert Sahra Wagenknecht konkrete politische Änderungsvorschläge. Dieser Abschnitt ist (mit einigen Ausnahmen) weitaus angenehmer zu lesen, als der vorherige Teil, da Wagenknecht sich auf das besinnt, was sie kann: Politik.
Das erste Kapitel beginnt mit einer bahnbrechenden Erkenntnis: Der Mensch sei, trotz der „viel beschworenen Individualisierung moderner Gesellschaften“ (Seite 205), ein Gemeinschaftswesen, das in Gemeinschaften lebt und das Miteinander braucht. Für sie ist eine Schlüsselkategorie zur Abgrenzung von Gemeinschaften die Unterscheidung zwischen zugehörig und nicht zugehörig. Sie argumentiert, dass Menschen eher ihren Familien und Gemeinschaften, mit denen sie gemeinsame Werte teilen, vertrauen, als Fremden. Damit hat sie erst einmal nicht unrecht.
Als nächstes führt sie mehrere Beispiele zu Gemeingütern an. Dabei spricht sie über eine Studie vom britischen Entwicklungsforscher Paul Collier, der den Einfluss kultureller Identität auf die Zusammenarbeit in dörflichen Gemeinschaften afrikanischer Länder untersucht hat. Sahra Wagenknecht bringt zusätzlich noch das Beispiel mittelalterlicher Dörfer mit ins Spiel, wo Wälder, Seen und Schafherden gemeinschaftlich benutzt wurden. Fazit: Je homogener eine Gemeinschaft, desto besser funktioniert Kooperation und desto eher vertrauen sich die Mitglieder der Gemeinschaft. Außerdem sollen die Beispiele zeigen, dass der Mensch ein kooperatives und gemeinschaftliches Wesen ist, statt ein sogenannter homo oeconomicus, also ein egoistisches, und sie sollen die These der „Mainstream-Ökonomen“ widerlegen, dass Gemeingüter immer ausgeplündert und am Ende zerstört werden.
Ein paar Abschnitte später sagt sie jedoch, dass der Grund, warum die Bewirtschaftung von Gemeingütern im Mittelalter funktionierte, der war, dass die Dörfer überschaubar und klar abgrenzt waren. Die mittelalterliche Welt unterscheide sich schon stark von unserer derzeitigen modernen und komplexen. Ich möchte auch hinzufügen, dass es bei dem angeführten Beispiel auch um das tägliche Überleben ging. Wenn nicht alle Mitglieder eines Dorfes gemeinsam am Strang zogen, drohte der Untergang des gesamten Dorfes. Das Überleben des Einzelnen stand im Vordergrund. Diese Problematik haben wir in unserer techno-kapitalistischen Welt nicht mehr.
In den nächsten Abschnitten kritisiert Sahra Wagenknecht – wie es sich für eine traditionelle Linke gehört – die kapitalistische Marktwirtschaft. Und das noch nicht einmal wirklich schlecht. Sie schreibt, dass „[d]ie Instrumente des Rechts und die Gesetze des Marktes faire Kooperation nicht erzwingen [können]“ (Seite 212). Die „unsichtbare Hand des freien Marktes“ könne nur in einer Ökonomie funktionieren, „in der gewisse Anstandsregeln gelten, deren Einhaltung der Markt selbst nicht garantieren kann“ (Seite 213).
Sahra Wagenknecht argumentiert, dass es der entfesselte und grenzenlose Kapitalismus sei, der Werte und Gemeinschaftsbindungen zerstört. Stetig wachsende Ungleichheit zerstört Vertrauen, Zusammenhalt und Mitgefühl, „weil Menschen, die in völlig unterschiedlichen Lebenswelten leben und anderen sozialen Schichten privat nicht mehr begegnen, sich immer weniger als Teil eines gemeinsamen Ganzen empfinden“ (Seite 213 f.). Ich würde noch hinzufügen, dass im Kapitalismus alles, und zwar wirkliches alles – von Religion zu Freundschaften zu Anti-Rassismus zu Progressivität bis hin zu Hobbys – zu einer Ware verkommt. Das trägt dazu bei, dass der Gemeinsinn weiter zerstört wird.
Für Sahra Wagenknecht steht fest: „eine Gesellschaft, die ihre Traditionen, ihre Werte und ihre Gemeinsamkeiten zerstört, zerstört den Kitt, der sie zusammenhält“ (Seite 214). Eine Demokratie funktioniere nur mit einem Wir-Gefühl, das wusste schon Aristoteles. Der war übrigens kein Freund der Demokratie, für ihn war Demokratie eine „entartete“ Staatsform, in der die Freien und die Armen das Sagen hätten. Die Demokratie sei die Dominanz der Armen, die dann den Tüchtigen und Wohlhabenden schaden. So viel dazu.
Hier noch eine interessante Stelle: In einem der Unterkapitel spricht Sahra Wagenknecht über Hartz-IV und Flüchtlinge. Sie argumentiert, dass der Grund, warum der Großteil der Deutschen heutzutage eher reserviert gegenüber den „Hartz-IV-Milieu“ sei, liege unter anderem an den „knapp 2 Millionen Menschen aus dem Nahen und Mittleren Osten“ (Seite 216), die zu uns geflüchtet sind. Rund 70 Prozent von ihnen leben bis heute von Hartz-IV, da sie hier große Probleme haben, eine Arbeit zu finden. Der Ruf nach Erhöhungen wird zunehmend stummer, da die Sozialleistungen immer mehr an Leute gehen, die „gar nicht dazugehören“ (Seite 217). Zersplitterte Gesellschaften und die Entfremdung zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen befördern den Abbau des Sozialstaates.
Ich persönlich finde diese Argumentation recht problematisch. Sahra Wagenknecht betreibt hier (wahrscheinlich unbewusst) Victim Blaming: die Flüchtlinge/Geflüchteten sind Schuld daran, dass nicht mehr über Hartz-IV gesprochen wird und nicht diejenigen, die für diese menschenverachtende Politik überhaupt verantwortlich sind. Wagenknecht verhält sich auch hier inkonsequent. Seitenweise schreibt sie darüber, dass die „traditionellen Linken“ doch die Beschützer:innen und Vertreter:innen der Unterprivilegierten seien. Wer ist unterprivilegierter, als ein Mensch, der aus seiner Heimat fliehen musste? Sahra Wagenknecht spielt eine Gruppe von Sozialschwachen gegen eine andere aus. Und war nicht auch „Internationalismus“ eine Flagge der „traditionellen Linken“? Was ist daraus geworden? Warum wird so sehr der Fokus auf das Nationale gelegt? Das ist eine inkonsequente Argumentation.
Um dieses Kapitel endlich abzuschließen: Was ist Sahra Wagenknechts Lösungsvorschlag? Was ist ihr Gegenmodell zum sogenannten „Linksliberalismus“? Ganz einfach: Eine Synthese aus „traditioneller Linken“ und „Wertekonservatismus“, sie nennt es „linkskonservativ“. Auf der einen Seite setze man sich für die Sozialschwachen und für Umverteilung ein, auf der anderen für Tradition, Gemeinschaft und Werte, ähnlich wie die SPD unter Willy Brandt und die momentanen Sozialdemokraten in Dänemark.
Ob das funktionieren soll, ist fraglich. Mit dieser Fusion wären weder die politischen Konservativen auf der Rechten noch die sogenannten „Linksliberalen“ zufrieden, sehen sich die beiden Gruppen doch als inkompatibel an. Und in den meisten Fällen bedeutet die Synthese der beiden Ideologien einfach nur die Übernahme rechter Methoden und Talking Points, im schlimmsten Fall wird die linke Gruppe einfach reaktionär. Wir haben es bei Slobodan Milošević, der sich dem Ethno-Nationalismus verschrieb und bei Gustav Noske, der Tausende von Genoss:innen mithilfe rechtsradikaler Freikorps abschlachten ließ, gesehen.
Mein Fazit – erste Hälfte anstrengend, zweite in Ordnung
Ich möchte eines gleich vorweg nehmen: Sahra Wagenknecht ist keine Reaktionäre, sie ist keine Rassistin, sie ist definitiv keine Faschistin und auf jeden Fall ist sie keine rote AfDlerin. Sie ist eine „traditionelle“ Linke, die einer Zeit hinterher trauert, die einfach nicht mehr existiert. Aber: in einigen Punkten hat sie recht.
Viele moderne Linke sind hypermoralisch, besonders wenn es um Sprache und Humor geht. Viele von ihnen sind herablassend und arrogant, Empathie ist ein Fremdwort. Man muss sich nur mal in den Filterblasen der sozialen Medien (besonders bei Twitter und Reddit) umschauen, um zu verstehen, was ich meine. Sie verkörpern das genaue Gegenteil von dem, was „links“ im Kern eigentlich ausgemacht hat: Elitarismus statt Egalitarismus, Ungleichheit statt Gleichheit, Hass statt Brüderlichkeit, Zwang und Verbote statt Freiheit.
Viele von ihnen verwechseln „links“ mit „grün“ und glauben, wenn sie sich vegan ernähren, wäre das ein revolutionärer Akt. Für viele ist „links“ einfach nur ein Label geworden, dass man sich raufklatschen kann, damit man hip wirkt. Sie zerren die verstaubten Leichen linker Köpfe aus ihren Gräbern, reißen ihnen die verrottete Haut von den staubigen Körpern und kleiden sich darin, doch wirklich was an der Welt ändern oder gar die Ideologie weiterentwickeln tun sie nicht.
Wenn einundzwanzigjährige Studenten auf der Bühne stehen, die Faust gen Himmel strecken, sich „revolutionär“ nennen und von „Klassenkampf“ brüllen, spüre ich nichts als Fremdscham. „Cringe“, wie es im englischen Jugendslang so schön heißt. Wie sang Ernst Busch doch gleich (mit der Melodie von Hanns Eisler und dem Text von Kurt Tucholsky)?
„Wer etwas diskutieren kann, wer einmal Marx gelesen, der hält sich schon für einen Mann und für ein höh‘res Wesen.“ Ist Ernst Busch eigentlich problematisch? Er sang schließlich auch mal „damit Deutschland den Deutschen gehört!“ Ich weiß es nicht. Kehren wir zurück zu Sahra Wagenknecht.
Ihr gefordertes Gegenprogramm ist solide, aber auch nichts Bahnbrechendes. Klar, sie hat schon recht, dass ohne Gemeinsinn und ohne gemeinsame Werte weder eine Demokratie noch eine Gesellschaft funktionieren kann.
Und auch die Forderungen nach einer höheren Steuer für Superreiche und Megakonzerne, für mehr Investitionen in Bildung, Soziales und Gesundheit, für europäische Innovation und eigene europäische Technik, für mehr Hilfe für die Unterprivilegierten, für weniger Rüstungsausgaben, stärkere Gewerkschaften, geregelte Zuwanderung, bessere Integration und mehr staatlicher Intervention in den kapitalistischen Markt sind alle in Ordnung und auch richtig, aber ihr Gegenprogramm ist weder ein sozialistisches noch gar ein kommunistisches – es ist ein sozialdemokratisches. Reformen und Umverteilung statt großer gesellschaftlicher Veränderungen oder gar Abschaffung der Klassen. Das ist nicht unbedingt negativ, aber dann frage ich mich, warum Sahra Wagenknecht noch in der Linken sitzt, wenn sie ideologisch gesehen viel verbundener mit der SPD zu sein scheint.
Und hier kommen wir auch schon zu den Problemen des Buches. Sie trauert einer vergangenen Zeit hinterher, einer Zeit in den 70ern, in der die SPD stark war. In der die SPD konservativer war. Sie romantisiert die „traditionellen Linken“ und genau in diesem Weltbild ist sie gefangen. Wie für „traditionelle Linke“ üblich, sieht sie den Menschen fast ausschließlich aus einer wirtschaftlichen Perspektive und ignoriert bzw. vernachlässigt die kulturelle Seite.
Der Mensch wird aber nicht nur durch seine ökonomische Situation geformt, sondern auch durch seine Identität, sein Gender, seine Religion und seine Race; der Mensch ist ein vielschichtiges Wesen, was nicht nur von einen Aspekt beeinflusst wird.
Aber da das Sahra Wagenknecht kaum bewusst ist, kann sie auch nicht befriedigend erklären, warum die neurechten Parteien so viele Arbeiter:innen anziehen und sie so zu den neuen „Arbeiterparteien“ geworden sind. Frau Wagenknecht schreibt, dass diese Parteien häufig ein wirtschaftsliberales Programm haben, was eigentlich die Arbeiter:innen abschrecken sollte, doch das passiert nicht. Im Gegenteil: die AfD ist in ihren Umfragewerten stabil bundesweit bei 10% bis 12%, in einzelnen Ländern stellen sie sogar die größte Kraft. Ein linkes Wirtschaftsprogramm garantiert keine hohen Werte, sonst würden die Arbeiter:innen doch alle zur MLPD oder zur DKP überlaufen.
Man kann diesen Erfolg auch nicht dadurch erklären, dass das alles Protestwähler:innen sind. Das stimmte vielleicht mal 2013, aber acht Jahre später ist von der bürgerlich-konservativen Maske doch nichts mehr übrig, besonders im Osten zeigt die AfD ihre hässliche faschistische Fratze. Das alles kann man nicht allein aus wirtschaftlicher Sicht erklären.
Die Neurechten sprechen die tief sitzenden (oftmals unbewussten) Ressentiments an, die in einem Teil der Bevölkerung sitzen. Diese Parteien sprechen die Menschen auf einer stark emotionalen Ebene an, sie ernähren sich von den Sorgen und Ängsten des Mittelstandes und der Arbeiterschaft. Sie flüstern dem primitiven Kern, der in uns allen steckt, zu. Faschismus ist nicht rational, er ist das völlige Gegenteil, er ist absolut irrational, brutal und primitiv. Und jede:r von uns kann zum Opfer werden, jede:r kann zum Faschisten oder zur Faschistin werden, denn in jeder:jedem von uns steckt dieser Kerngedanke. Wie Trotzki schon sagte: „Nicht jeder erbitterte Kleinbürger könnte ein Hitler werden, aber ein Stückchen Hitler steckt in jedem von ihnen.“ Trotzki verstand es besser, als die sogenannten „traditionellen Linken“.
Auch begeht Sahra Wagenknecht den klassischen Fehler Anti-Globalismus und Anti-Kapitalismus mit „links“ gleichzusetzen. Faschist:innen und andere Rechtsradikale waren damals anti-kapitalistisch eingestellt und viele von ihnen sind es auch heute noch. Es sind keine exklusiv linken Eigenschaften. Man muss nur mal Trumps Reden anhören oder eine Stunde lang Fox News schauen, dann bekommt man seine Dosis Anti-Globalismus.
Kommen wir nun zu dem Punkt, der mich an Sahra Wagenknechts Buch am meisten stört: Die erste Hälfte, in der sie über die „Linksliberalen“ spricht. Lasst euch von mir sagen, dass diese Passagen unendlich anstrengend und nervtötend sind. Polemik über Polemik, die sich endlos wiederholt. Ich habe so oft mit den Augen gerollt, dass ich den größten Teil des Inhaltes gar nicht mitbekommen habe.
Die meiste Kritik von links bezieht sich auf die erste Hälfte des Buches und ich kann auch verstehen warum. Die Passagen sind in einem so polemischen, arroganten und überheblichen Tonfall geschrieben, dass man sich gar nicht mehr mit dem Inhalt beschäftigen möchte. Die Sätze sind stellenweise bewusst so geschrieben worden, dass es unvermeidlich war, dass eine Kontroverse daraus entstand.
Wäre das Buch nicht so polemisch geschrieben, würden wahrscheinlich auch mehr Leute Frau Wagenknecht zustimmen, doch da sie so einen harten Frontalangriff fährt, erzeugt sie eine Kontroverse, wodurch nicht mehr über das Wichtige, sondern über die Angriffe gesprochen wird. Ist das beabsichtigt? Möchte Sahra Wagenknecht, dass man über das Buch redet oder über sie?
Wir haben hier auch folgende Situation: Ein Elfenbeinturm kritisiert einen anderen Elfenbeinturm. Sahra Wagenknecht ist eine wohlhabende, privilegierte Akademikerin, die eine wohlhabende, privilegierte Akademikerschicht kritisiert, weil sie wohlhabend und privilegiert sind und ihr Leben für das Maß der Dinge halten.
Sie greift die Gender-Theorie und die Identitätspolitik an, obwohl sie von den komplexen Zusammenhängen und vielschichtigen Argumentationen und Theorien keine wirkliche Ahnung zu haben scheint. Sie spricht über Michael Foucault, Judith Butler und Post-Strukturalismus, aber ihre Analyse ist sehr oberflächlich. Es bleibt auf dem Niveau einer einfachen „wokeness“-Kritik.
Und das ist auch ein gutes Fazit für das Buch insgesamt: oberflächlich. Sie spricht über alle möglichen Themen und scheint über alles ein wenig Bescheid zu wissen, doch sie geht nicht tief in die Materie hinein. Sie erzählt nichts Neues. Keiner ihrer Vorschläge ist bahnbrechend, alles hat man schon mal irgendwo anders gehört oder gelesen. Sie betritt keine neuen Pfade, sondern begibt sich auf bereits altbekannte. Wäre die erste Hälfte besser gestaltet, wäre das Buch ganz in Ordnung. Doch in diesem Zustand ist es einfach nur oberflächlich und mittelmäßig.
Aber hey, wenigstens hat man mal wieder über Sahra Wagenknecht gesprochen und das nächste Interview bei irgendeiner reaktionären Zeitung ist bestimmt sicher.