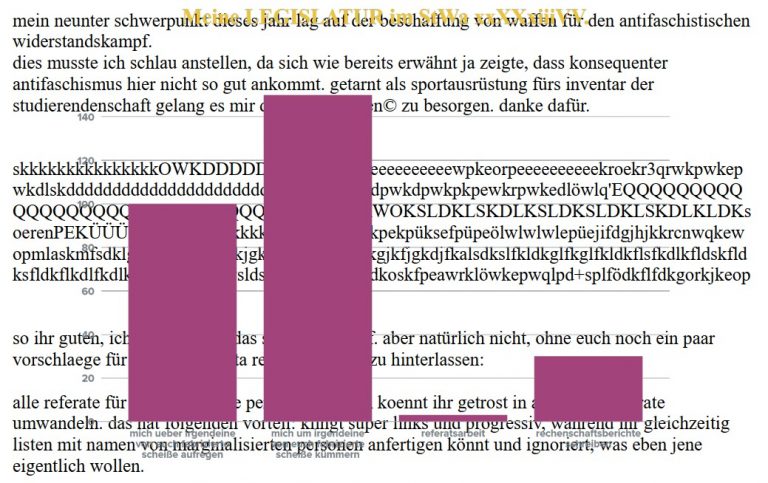Praktikumserlebnis in der Gedenkstätte für die Opfer der „Euthanasie“-Morde

Praktika können spannende Erfahrungen sein, doch als Studienanfänger_in weiß man oft nicht, was eine_n erwartet. Unser Redakteur spricht deshalb über seine Praktikumserlebnisse in einer Gedenkstätte und warum man sich nicht von Furcht lenken lassen sollte. Von Maximilian Schulz.
Das Praktikum im Studium
Jede_r Student_in kennt das: Irgendwann im Verlaufe des Studiums muss man ein Pflichtpraktikum, das zu den Studieninhalten passt, absolvieren. Manche Student_innen haben ein wenig Scheu und Angst davor. Ich bin da keine Ausnahme. Was wird eine_n im Job erwarten? Wie werden die Kolleg_innen auf eine_n reagieren? Welche Aufgaben wird man bekommen? Wird es schwierig sein? Wird man es schaffen? Diese Fragen können eine_n quälen, sogar in der Nacht wach halten. Um Studien- und Praktikumsanfänger_innen ein wenig die Furcht zu nehmen, möchte ich mit euch meine Erfahrungen im Praktikum bei der Gedenkstätte für die Euthanasie-Opfer Brandenburg an der Havel teilen.
Einige Vorabinformationen: Mein Praktikum dauerte genau sechs Wochen. Ich habe es vom 11. August 2020 bis zum 18. September 2020 absolviert. Um die Privatsphäre der Mitarbeiter_innen zu wahren, werde ich auf die Nennung von Namen verzichten. Gut, fangen wir an. Das Anfangsprozedere war noch relativ leicht. Bewerbung schreiben, Lebenslauf verfassen, Dokumente abschicken, dies sollte übrigens mindestens einen bis drei Monate (wenn nicht sogar noch früher) vor Praktikumsantritt getan werden. Nach ein paar Tagen erhielt ich auch schon eine Antwort von der Leiterin höchstpersönlich. Sie versicherte mir, dass ich gerne ein Praktikum in der Gedenkstätte absolvieren dürfte, es müssten aber noch ein paar Formalitäten geklärt werden. Nachdem diese erledigt waren, stand dem Praktikum nichts mehr im Wege. Lasst es mich so sagen: Ich war mehr als nur nervös! Meine Nervosität ließ sich gar nicht in Worte fassen, so aufgeregt war ich.

Der Tag des Antritts war bald gekommen. Ich zog mir ein Hemd und meine Anzugschuhe an und machte mich auf den Weg zur Arbeit. Bei meiner Ankunft wurde ich von der Leiterin und einer jungen Mitarbeiterin freundlich begrüßt. Wir setzten uns auf eine Bank und unterhielten uns kurz. Danach führte mich die junge Mitarbeiterin zum Arbeitsort. Ich kam zu einem relativ ungünstigen Zeitpunkt an. Wir erinnern uns, im Sommer war da ja schon diese Pandemie. Die meisten Mitarbeiter_innen der Gedenkstätte waren deswegen noch im Homeoffice und kamen erst im Laufe der Woche physisch zur Arbeit, was für mich bedeutete, dass ich erst mal alleine war.
Die junge Mitarbeiterin gab mir ein paar Bücher und sagte mir, dass ich mich ja vorerst in das Thema „Euthanasie und Gedenkstätte“ einlesen könne. Danach schaute ich mir noch die Ausstellung an.
Die Arbeitsroutine beginnt
Im Laufe der nächsten Tage lernte ich dann auch die restlichen Mitarbeiter_innen kennen. Es waren alles sehr nette Menschen. Man zeigte mir meinen Arbeitsplatz (im Archiv) und gab mir auch schon bald die erste große Aufgabe, mit der ich mich über die nächsten Wochen beschäftigte. Ich sollte die Bestände über die Hinrichtungsopfer digitalisieren (an dieser Stelle sei anzumerken, dass es zwei Gedenkstätten in Brandenburg an der Havel gab: Einmal für die Opfer der „Euthanasie“-Morde und einmal für die Hinrichtungsstätte in Brandenburg-Görden).
Was hieß das genau? Nun, die Aufgabe bestand darin, Fotos (wenn welche vorhanden waren) und die dazugehörigen Dokumente einzuscannen und in digitale Ordner zu platzieren. Das war eine wirklich kolossale Aufgabe. Wenn ich mich richtig erinnere, waren das fast dreihundert Personen! Dafür brauchte ich auch fünf Wochen, aber immer der Reihe nach. Zuerst musste ich mir einen Überblick verschaffen. Ich schaute in die vielen, vielen Excel-Tabellen auf dem Gedenkstättenserver und notierte mir, welches Material eigentlich vorhanden und wer ein Hinrichtungsopfer war.
Dann erstellte ich eine eigene Excel-Tabelle, in die ich die gefundenen Informationen eintrug. Dafür brauchte ich, glaube ich, drei bis vier Tage und erst dann konnte ich mit der eigentlichen Arbeit anfangen. Ich ging zu dem Regal mit den ganzen Aktenordnern, suchte die richtigen heraus und las die darin enthaltenen Dokumente. Dann bewegte ich mich zum Kopierer und scannte und scannte und scannte. Danach wurden die eingescannten Informationen eingeordnet. Und das machte ich fünf Tage die Woche, von 9 bis 17.30 Uhr.

Das klingt jetzt erst mal monoton und öde, was es an manchen Tagen auch war, aber um ehrlich zu sein, mir machte das nichts aus. Es hatte fast schon eine Art von meditativer Routine. Ich konnte selbstständig und in meinem eigenen Tempo arbeiten. Nebenbei arbeitete ich gedanklich an einer neuen Kurzgeschichte. Und ich habe auch so viel durch das Lesen der unzähligen Anklageschriften, Urteilsschriften und Abschiedsbriefe gelernt. Wusstet ihr, dass die Nationalsozialisten Menschen mit dem Fallbeil hingerichtet haben, weil diese Witze gemacht oder in einem Nebensatz etwas Schlechtes über die Wehrmacht erwähnt haben? Wehrkraftzersetzung nannte sich das. Dafür gab es meistens den Tod.
Ich las über mutige Kommunist_innen, die versuchten, sich dem elendigen Nazi-Regime zu widersetzen. Über die Zeugen Jehovas, die sich weigerten, ihren Blutzoll an die Wehrmacht zu zahlen. Über völlig normale Menschen, die genug hatten vom Krieg. Sie alle zahlten mit ihrem Leben. Ihr sollt aber nicht glauben, dass ich nur am Kopierer stand. Ich übernahm auch einige andere Aufgaben. Zum Beispiel durfte ich einige Beiträge für die Instagramseite der Gedenkstätte schreiben.
Ihr müsst wissen, dort wo die Gedenkstätte sich heute befindet, befand sich im Dritten Reich eine sogenannte „Landes-Pflegeanstalt“. Natürlich war das nur eine Ablenkung für die Bevölkerung, denn in Wahrheit war es eine T4-Tötungsanstalt. (Vermeintlich) Psychisch beeinträchtigte Männer, Frauen und Kinder wurden rücksichtslos und brutal ermordet (über 9.000 Menschen starben in einem Zeitraum von 1939 bis 1940 mitten in Brandenburg an der Havel), dafür hatten die Nationalsozialisten sogar eine Gaskammer errichten lassen. Es waren erste Testläufe für das, was später in der Shoah enden sollte, den industriellen Massenmord an Juden und Jüdinnen. Doch die dunkle Geschichte des Ortes hört da nicht auf.
Bevor es eine Vernichtungsanstalt von „lebensunwertigem Leben“ wurde, war es von 1933 bis 1934 ein sogenanntes „Frühes KZ“, ein Vorläufer der später auftretenden Konzentrationslager. Auf dem Gelände des Alten Zuchthauses hielt die SS politische Häftlinge gefangen und folterte diese bestialisch. Drei Kommunist_innen, darunter die Stadtabgeordnete Gertrud Piter, wurden von den SS-Wachmännern umgebracht. Darüber habe ich vier Beiträge geschrieben, die allesamt auf der Instagramseite der Gedenkstätte (gedenkstaettenbrandenburg) zu finden sind. Doch rücken wir erst mal von diesem doch sehr düsteren Thema ab.
Die anderen Seiten des Jobs

Ich habe auch Aufgaben erledigt, die man jetzt nicht unbedingt mit Gedenkstättenarbeit in Verbindung bringen würde, wie zum Beispiel Gartenarbeit oder das Verteilen von Flyern. Ich durfte auch an Studientagen teilnehmen und sehen, was es heißt, pädagogisch zu arbeiten. Und ich habe gelernt, was für ein Rattenschwanz an Bürokratie und Öffentlichkeitsarbeit an diesem Beruf hängt. Der Großteil des Jobs bestand darin, sich mit verschiedenen Interessengruppen auseinanderzusetzen, Anträge zu stellen und Events (z.B. Studientage, Seminare und Gedenkfeiern) zu planen.
In meiner letzten Woche bekam ich noch den Auftrag, eine Übersicht über die Zeugen Jehovas, die in Brandenburg-Görden während des Dritten Reiches und der DDR inhaftiert waren, zu erstellen. Sagen wir mal so, ich bin jetzt so etwas wie ein Experte in diesem Gebiet. Das war auch eine sehr interessante Erfahrung, obwohl die Erlebnisse sich größtenteils ähnelten. Und ja, ich durfte auch zweimal den obligatorischen Kaffee machen.
Der Abschied
An meinem letzten Tag gab es ein kleines Abschiedsfest. Es gab Kaffee und Kuchen, die Mitarbeiter_innen überreichten mir sogar einen Katalog über ihre Ausstellung. Man bedankte sich auch herzlich für meine Mitarbeit. Zum Abschluss lässt sich sagen, dass ich eine Menge Spaß an meinem Praktikum hatte und meine Ängste völlig unbegründet waren. Es gab zwar auch einige Tiefs und schlechte, langweilige Tage, doch welcher Job hat die nicht?
Ich für meinen Teil habe viel gelernt und würde dort auf jeden Fall nochmal arbeiten. Manchmal muss man über seinen eigenen Schatten springen, manchmal muss man auch einfach mal machen, dann wird man dafür auch belohnt. Es gibt keinen Grund, vor einer neuen Umgebung Angst zu haben. Nur wenn wir unsere Ängste überwinden, können wir unsere Ziele erreichen.